Dieser Beitrag wird ständig aktualisiert und enthält sämtliche hier im Blog besprochenen Bücher und Zeitschriften. Die Sortierung ist bei Büchern alphabetisch nach AutorIn, bei den Zeitschriften nach Reihe und Titel. Die Verlinkungen verweisen auf den jeweiligen Beitrag, in dem sie besprochen wurden. Ab September 2019 ist das Format monatlich und mit wesentlich ausführlicheren Besprechungen; vorher waren es Jahreslisten mit Kurzkommentaren. Ab Januar 2021 erhält jede Besprechung einen ausführlichen und argumentativeren Einzelartikel.
A
Acemoglu, Daron – Warum Nationen scheitern (Jahresliste 2014/15)
Alter, Jonathan – The Center holds. Obama and his enemies (Jahresliste 2013/14) (Jahresliste 2018/19)
Applebaum, Ann – Iron Curtain (Monatsliste Dezember 2021)
Armstrong, Karen – The Great Transformation. The beginning of our religious traditions (Monatsliste Januar 2020)
Attewell, Steven – Race for the Iron Throne (Jahresliste 2013/14)
B
Baker, Dean – The conservative nanny state (Jahresliste 2014/15)
Bannerjee, Abhijit V.- Poor Economics. Ein Plädoyer für ein neues Verständnis von Armut (Jahresliste 2013/14) (Jahresliste 2015/17)
Barth, Rüdiger – Die Totengräber. Der letzte Winter der Weimarer Republik (Rezension 2018)
Beevor, Anthony – Der spanische Bürgerkrieg (Jahresliste 2018/19)
Baumann, Claudia – Pocket Recht (Jahresliste 2018/19)
Bednarz, Liane – Die Angstprediger. Wie rechte Christen die Gesellschaft unterwandern (Jahresliste 2018/19)
Bernhardt, Markus – Das deutsche Kaiserreich (Monatsliste August 2021)
Blume, Bob – ABC für wissenshungrige Mediennutzer (Jahresliste 2018/19)
Blume, Bob – Deutschunterricht digital (Rezension Mai 2022)
Blume, Bob – Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse, und wie wir sie ändern können (Rezension Mai 2022)
Bösch, Rank – Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann (Rezension Dezember 2023)
Bohne, Michael – Presidents in crisis. Tough decisions in the White House from Truman to Obama (Jahresliste 2018/19)
Bola, JJ – Sei kein Mann (Monatsliste November 2021)
Boyd, Julia – Travellers in the Third Reich. The rise of fascism through the life of everyday people (Monatsliste Februar 2021)
Brechenmacher, Thomas – Im Sog der Säkularisierung (Rezension Juni 2022)
Brecher, Gary – The War Nerd Dispatches (Monatsliste April 2020)
Brecher, Gary – The War Nerd Iliad (Monatsliste April 2020)
Bregman, Rutger – Humankind (Monatsliste November 2021)
Breen, Marte/Jordhal, Jenny – Rebellische Frauen. Women in Battle (Jahresliste 2018/19)
Brinkmann, Hannah – Gegen mein Gewissen (Rezension April 2022)
Brockmaier, Sarah/Rothmann, Philipp – Krieg vor der Haustür. Die Gewalt in Europa und was wir dagegen tun können (Monatsliste November 2019)
Brockschmidt, Annika – Amerikas Gotteskrieger. Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet (Rezension August 2022)
Brodersen, Kai – Ich bin Spartacus (Rezension April 2022)
Brooks, Max – World War Z (Rezension Januar 2022)
Brown, Achie – Der Mythos vom starken Führer (Jahresliste 2018/19)
Brusatte, Steve – The Rise and Fall of Dinosaurs (Monatsliste November 2019)
Bryson, Bill – At home. A short history of private life (Rezension April 2022)
Burkhardt, Johannes – Deutsche Geschichte der Frühen Neuzeit (Rezension April 2022)
Buchsteiner, Jochen – Die Flucht der Briten aus der europäischen Utopie (Jahresliste 2018/19)
Burns, Charles – Black Hole (Rezension November 2022)
Büttner, Ursula – Weimar. Die überforderte Republik (Monatsliste Mai 2020)
Butter, Michael – Nichts ist so, wie es scheint: Über Verschwörungstheorien. (Jahresliste 2018/19)
Burgdorff, Stephan/Habbe, Christian – Als Feuer vom Himmel fiel (Monatsliste Mai 2020)
Burns, Charles – Black Hole (Rezension Dezember 2022)
C
Carens, Josep H. – Fremde und Bürger. Warum die Grenzen offen sein sollten (Jahresliste 2018/19)
Carnegie, Dale – Wie man Freunde gewinnt (Jahresliste 2017/18)
Carlin, Dan – The end is always near (Monatsliste November 2019)
Chait, Jonathan – Audacity. How Barack Obama defied his critics and remade America‘ (Jahresliste 2015/17)
Chamberlain, Paul Thomas – The Cold War’s Killing Fields. Rethinking the Long Peace (Jahresliste 2018/19)
Chute, Hillary – Maus Now (Rezension Januar 2023)
Clark, Christopher – Die Schlafwandler. Wie Europa in den 1. Weltkrieg zog (Jahresliste 2013/14)
Clark, Christopher – Revolutionary Spring: Fighting for a New World 1848-1849 (Rezension Juli 2023)
Clark, Christopher – Von Zeit und Macht (Monatsliste März 2021)
Cline, Eric – 1177 – The year in which civilization collapses (Monatsliste Februar 2021)
Clinton, Hillary – What happened (Rezension 2017)
Coates, Ta-Nehisi – Between the world and me (Jahresliste 2015/17)
Coates, Ta-Nehisi – The Water Dancer (Monatsliste März 2020)
Coates, Ta-Nehisi – We were eight years in power (Jahresliste 2017/18)
Cohen, Marty – The party decides (Jahresliste 2013/14)
Cohen, Michael – American Maelstrom (Jahresliste 2015/2017)
Collins, Suzanne – Flammender Zorn (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Juni 2021)
Collins, Suzanne – Gefährliche Liebe (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Juni 2021)
Collins, Suzanne – Tödliche Spiele (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Juni 2021)
Conze, Eckart – Schatten des Kaiserreichs (Monatsliste Dezember 2021)
Corey, James S.A. – Abaddons Tor (Jahresliste 2015/17)
Corey, James S. A. – Babylons Asche (Jahresliste 2017/18)
Corey, James S. A. – Calibans Krieg (Jahresliste 2015/17)
Corey, James S. A. – Cibola brennt (Jahresliste 2017/18)
Corey, James S. A. – Leviathan erwacht (Jahresliste 2015/17)
Corey, James S. A. – Leviathan fällt (Monatsliste Dezember 2021)
Corey, James S. A. – Nemesis-Spiele (Jahresliste 2017/18)
Corey, James S. A. – Pesepolis erhebt sich (Jahresliste 2017/18)
Corey, James S. A. – Strange Dogs (Jahresliste 2017/18)
Corey, James S. A. – Tiamats Zorn (Monatsliste November 2019)
Corey, James S. A. – The vital abyss (Jahresliste 2017/18)
Cowey, Jefferson – The Great Exception (Jahresliste 2017/18)
D
Dachs, Gisela – israel kurzgefasst (Jahresliste 2018/19)
Daub, Adrian – Cancel Culture Transfer (Rezension April 2023)
Daub, Adrian – What Tech Calls Thinking (Rezension September 2023)
Dausend, Peter – Alleiner kannst du gar nicht sein (Monatsliste Juni 2021)
Desan, Suzanne – The French Revolution and the Age of Napoleon (Monatsliste Januar 2020)
Diebel, Martin – Die Stunde der Exekutive (Monatsliste November 2020)
Dikötter, Frank – Maos Großer Hunger (Jahresliste 2018/19)
Dikötter, Frank – Populismus, Diktator werden und Wege zur Macht (Monatsliste April 2020)
Diner, Dan – Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935-1942 (Rezension September 2022)
Doering-Manteuffel, Anselm – Die Deutsche Frage und das europäische Staatensystem 1815-1871 (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste September 2021)
Doering-Manteuffel, Anseln – Die Entmündigung des Staates (Jahresliste 2014/15)
Doering-Manteuffel, Anselm – Nach dem Boom (Jahresliste 1917/18) (Rezension November 2022)
Doering-Manteuffel, Anselm/Baberowski, Jörg – Ordnung durch Terror (Jahresliste 2015/17)
Donovan, Tristan – Replay. The history of video games (Rezension November 2023)
Dos Passos, John – Mr. Wilson’s War (Rezension April 2022)
Doyle, Peter – Percy. A story of 1918 (Rezension November 2022)
Doubler, Michael D. – Closing with the enemy. How GIs fought the war in Europe, 1944-1945 (Rezension April 2022)
Draper, Robert – To start a war. How the Bush administration took America into Iraq (Monatsliste Oktober 2022)
Dreyer, Robert – Als die Römer frech geworden. Varus, Hermann und die Katastrophe im Teutoburger Wald (Rezension Juni 2023)
Duncan, Mike – Before the Storm (Jahresliste 2017/18)
E
Eastman, Kevin/Laird, Peter – The Last Ronin (Rezension Januar 2024)
Ebbinghaus, Uwe/Wiele, Jan – 33 (fast) perfekte Popsongs (Rezension Juni 2022)
Ebert, Thomas – Die Zukunft des Generationenvertrags (Jahresliste 2018/19)
Edgerton, David – The shock of the old (Jahresliste 2017/18)
Freed, Alexander – Rogue One (Monatsliste Januar 2020)
Ebert, Roger – The Great Movies (Monatsliste Juni 2020)
Ehling, Holger – Pocket Portugal (Monatsliste August 2021)
Ehling, Scott – Pocket Großbritannien (Jahresliste 2018/19)
Ehnts, Dirk – Modern Monetary Theory (Rezension Februar 2022)
Ehrman, Bart – Misquoting Jesus (Monatsliste Februar 2020)
Eisenstadt, Shmuel – Die Vielfalt der Moderne (Rezension November 2023)
El-Mafaalani, Aladdin – Das Integrationsparadox (Jahresliste 2018/19)
El Ouassil, Samira/Karig, Friedemann – Erzählende Affen (Rezension Mai 2022)
Elliot, Paul – Legions in crisis (Jahresliste 2017/18)
Elkins, Caroline – Legacy of violence (Rezension April 2023)
Engelstein, Laura – Russia in flames (Jahresliste 2018/19)
Evans, Richard J. – Das Dritte Reich. Aufstieg (Jahresliste 2014/15)
Evans, Richard J. – Das Dritte Reich. Diktatur (Jahresliste 2014/15)
Evans, Richard J. – Das Dritte Reich. Krieg (Jahresliste 2014/15)
Evans, Richard J. – Das europäische Jahrhundert (Jahresliste 2017/18)
F
Ferguson, Niall – Krieg der Welt (Monatsliste Oktober 2021)
Freedman, Lawrence – Strategy. A history (Jahresliste 2015/17)
Feldenkirchen, Markus – Die Schulz-Story (Jahresliste 2017/18)
Flix – Faust. Der Tragödie erster Teil (Rezension April 2022)
Foner, Eric – The Second Founding (Monatsliste Februar 2021)
Foot, John – Blood and Power. The Rise and Fall of Italian Fascism (Rezension Oktober 2023)
Frankel, Valerie – Katniss the Catnip (Monatsliste August 2021)
Franz, Markus – Lehrer, ihr müsst schreiben lernen! (Jahresliste 2018/19)
Freeman, Joana B. – The Field of Blood (Jahresliste 2018/19)
Frerich, Kai – Als das Rad zerbrach (Rezension April 2022)
Fry, Stephen – Mythos (Monatsliste August 2021)
Fry, Stephen – Heroes (Monatsliste Juni 2021)
Fry, Stephen – Troy (Monatsliste Juni 2021)
Fücks, Ralf – Das alte Denken der neuen Rechten (Monatsliste Februar 2021)
Fündling, Jörg – Kaiser von morgens bis abends (Rezension April 2022)
Fukuyama, Francis – Liberalism and its discontents (Rezension Dezember 2022)
Fukuyama, Francis – Political order and political decay (Jahresliste 2014/15)
Fukuyama, Francis – The origins of political power (Jahresliste 2014/15)
G
Gabrielle, Matthew/Perry, David M. – The Bright Ages. A new history of medieval Europe (August 2022)
Gaiman, Nell – Death (September 2022)
Gaiman, Neil – Overture (Juli 2022)
Gaiman, Neil – The Sandman Deluxe Edition, Volume 1 (Monatsliste Juli 2021) (Monatsliste September 2021)
Gaiman, Neil – The Sandman Deluxe Edition, Volume 2 (Monatsliste Juli 2021) (Monatsliste Oktober 2021)
Gaiman, Neil – The Sandman Deluxe Edition, Volume 3 (Monatsliste Oktober 2021)
Gaiman, Neil – The Sandman Deluxe Edition, Volume 5 (Rezension Februar 2022)
Garcia, Elio/Antonsson, Linda – Rise of the Dragon. An illustrated history of the Targaryen dynasty, part 1 (Rezension November 2022)
Garcia, Hector – A geek in Japan (Jahresliste 2013/14)
Garland, Robert – The other side of history. Daily life in the Ancient World (Monatsliste März 2020)
Gerse, Roland – Die Heilung der Welt (Rezension Mai 2023)
Gerten, Dieter – Wasser: Knappheit, Klimawandel, Welternährung (Jahresliste 2018/19)
Gerwarth, Robert – November 1918. The German Revolution (Monatsliste Februrar 2021)
Gerwarth, Robert – The Vanquished (Monatsliste Juni 2021)
Ginsburg, Tobias – Die letzten Männer des Westens (Monatsliste November 2021)
Gnauck, Gerhard – Polen verstehen (Monatsliste Oktober 2019)
Goldschmidt, Arthur Jr – A concise history of the Middle East (Jahresliste 2017/18)
Görtemaker, Manfred – Die Berliner Republik (Monatsliste April 2021)
Gopnik, Adam – A thousand small insanities. The moral adventure of liberalism (Monatsliste September 2019)
Gordon, Robert J. – The Rise and Fall of American Growth (Jahresliste 2017/18)
Gore, Al – An inconvenient sequel. Speaking truth to power (Jahresliste 2017/18)
Graeber, David – The Dawn of Everything (Monatsliste November 2021)
Green, John – Das Schicksal ist ein mieser Verräter (Rezension Mai 2022)
Green, John – The Anthropocene, reviewed (Rezension Juli 2022)
Gümüsay, Kübra – Sprache und Sein (Monatsliste Februar 2021)
H
Haardt, Oliver – Bismarcks ewiger Bund (Monatsliste Oktober 2021)
Hammouti-Reinke, Narinam – Ich diene Deutschland (Monatsliste Oktober 2020)
Hamori, Esther – God’s Monsters: Vengeful Spirits, Deadly Angels, Hybrid Creatures, and Divine Hitmen of the Bible (Rezension Dezember 2023)
Harari, Yuval Novah – Homo Deus. Eine kurze Geschichte von morgen (Jahresliste 2017/18)
Harford, Tim – How to make the world add up (Rezension Mai 2023)
Harford, Tim – The next fifty things that will make the modern economy (Rezension März 2023)
Harper, Kyle – Fate of Rome: Climate, Disease, and the End of an Empire (Oktober 2022)
Harris, Robert – V2 (Monatsliste Dezember 2020)
Hartmann, Michael – Die Abgehobenen. Wie die Eliten die Demokratie gefährden (Jahresliste 2018/19)
Hasters, Alice – Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten (Monatsliste Dezember 2020)
Hayes, Chris L. – A colony in a nation (Jahresliste 2018/19)
Hayes, Chris L. – Twilight of the Elites (Jahresliste 2015/17)
Hayes, Peter – Warum? Eine Geschichte des Holocaust (Monatsliste Mai 2020)
Hecken, Thomas – Das Versagen der Intellektuellen. Eine Verteidigung des Konsums gegen seine deutschen Verächter (Jahresliste 2015/17)
Hennen, Bernhard – Die Phileasson-Saga 1: Nordwärts (Rezension Dezember 2023)
Hennen, Bernhard – Die Phileasson-Saga 2: Himmelsturm (Rezension Dezember 2023)
Herbert, Frank – Dune (Jahresliste 2017/18)
Herbert, Ulrich – Die Geschichte der Ausländerpolitik in Deutschland (Jahresliste 2018/19)
Herring, George C. – From colony to superpower. US foreign relations since 1776 (Jahresliste 2015/17)
Herrmann, Nadja – Erzählmirnix (Jahresliste 2015/17)
Herrmann, Nadja – Erzählmirnix. Das Leben mit Menschen (Monatsliste August 2021)
Herrmann, Nadja – Fettlogik überwinden (Rezension 2017)
Herrmann, Ulrike – Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen (Monatsliste November 2020)
Hibberd, James – Fire cannot kill a dragon (Monatsliste Juni 2021)
Hill, Joe/Rodriguez, Gabriel – Locke&Key (Monatsliste Juli 2021)
Hilmes, Oliver – Schattenzeit. Deutschland 1943: Alltag und Abgründe (Rezension September 2023)
Hirshman, Linda – The reckoning. The epic battle against sexual harassment (Monatsliste November 2019)
Höfgen, Maurice – Teuer! Die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik (Rezension April 2023)
Hogeland, William – Founding finance (Jahresliste 2013/14)
Holland, James – War in the West. A new history, Vol. 1 (Jahresliste 2017/18)
Holland, James – War in the West. A new history, Vol. 2 (Jahresliste 2017/18)
Holland, Tom – Dominion. The making of the Western mind (Monatsliste September 2019)
Holland, Tom – Dynastie. Glanz und Elend der Kaiser von Augustus bis Nero (Jahresliste 2015/17)
Horst, Ernst – Nur keine Sentimentalitäten! Wie Erika Fuchs Entenhausen nach Deutschland versetzte (Jahresliste 2017/18)
Hotta, Eri – Japan 1941. Countdown to Infamy (Jahresliste 2013/14)
Howe, Daniel Walker – What hath god wrought. The transformation of America, 1815-1845 (Jahresliste 2015/17)
Howey, Hugh – Wool (Rezension Februar 2024)
Huf, Hans-Christian – Mit Gottes Segen in die Hölle (Monatsliste September 2021)
I
Issenberg, Sascha – The victory lab (Jahresliste 2014/15)
J
Janega, Ellen – The Once and Future Sex: Going Medieval on Women’s Roles in Society (Rezension Dezember 2023)
Jankowski, Paul – All against all. The Long Winter of 1933 and the Origins of the Second World War (Rezension Januar 2023)
Jensen, Frances – Teenager-Hirn (Monatsliste August 2020)
Jessen, Olaf – Verdun 1916 (Monatsliste September 2020)
Jürgens, Konrad/Hoffmann, Rainer/Schildmann, Christian – Arbeit transformieren! (Monatsliste Juni 2020)
Judt, Tony – Das vergessene 20. Jahrhundert (Jahresliste 2018/19)
Judt, Tony – Die Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg (Jahresliste 2014/15) (Jahresliste 2017/18) (Monatsliste März 2021)
Jünger, Ernst – In Stahlgewittern (Jahresliste 2014/15)
Jungfer, Klaus – Die Stadt in der Krise. Manifest für starke Kommunen (Jahresliste 2018/19)
Juul, Jesper – Aggression. Warum sie für unsere Kinder notwendig ist (Monatsliste September 2019)
Juul, Jesper – Gespräche mit Eltern (Monatsliste Oktober 2020)
K
Kaelble, Hartmut – Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat. Europa 1945-1989 (Rezension Februar 2023)
Kaplan, Fred – The bomb. Presidents, generals and the secret history of nuclear war (Monatsliste April 2020)
Kaminski, Michael – The secret history of Star Wars (Jahresliste 2017/18)
Karl, Michaela – Geschichte der Frauenbewegung (Monatsliste Juni 2020)
Kast, Bas – Der Ernährungskompass (Monatsliste Februar 2020) (Rezension Juli 2023)
Katz, Jonathan – Gangsters of Capitalism (Rezension März 2022)
Katznelson, Ira – Fear Itself (Monatsliste März 2021)
Kelman, Ari/Fetter-Vorm, Jonathan – Battle Lines. A graphic history of the Civil War (Monatsliste September 2021)
Kennedy, David M./McLachlan, Donald J. – Freedom from Fear. The American People in Depression and War, 1929-1945 (Jahresliste 2015/17)
Kershaw, Ian – Achterbahn (Monatsliste August 2021)
Kershaw, Ian – Fateful Choices (Jahresliste 2015/17)
Kershaw, Ian – Hitler, 1889-1936 (Jahresliste 2013/14)
Kershaw, Ian – Hitler, 1936-1945 (Jahresliste 2013/14)
Kersten, Jens/Neu, Claudia/Vogel, Berthold – Politik des Zusammenhalts (Monatsliste Juni 2020)
Kindt, Matt – Mind MGMT (Rezension März 2023)
King, Stephen – On writing (Jahresliste 2018/19)
Knapp, Robert – Römer im Schatten der Geschichte (Monatsliste April 2020)
Koeppen, Wolfgang – Tauben im Gras (Rezension Dezember 2022)
Körner, Thorsten – In der Männerrepublik. Wie Frauen die Politik eroberten (Monatsliste Juni 2020)
Kortüm, Hans-Henning – Kriege und Krieger 500-1500 (Jahresliste 2013/14)
Krastev, Ivan/Holmes, Stephen – Das Licht, das erlosch (Monatsliste April 2021)
Kruse, Kevin – Myth America: Historians Take On the Biggest Legends and Lies About Our Pastv (Rezension Januar 2024)
L
Lahl, Kersten/Varwick, Johannes – Sicherheitspolitik verstehen (Jahresliste 2018/19)
Lechner, Auguste – Die Nibelungen (Monatsliste Juni 2021)
Leonard, Christopher – Kochland. The Secret History of Koch Industries and Corporate Power in America (Rezension August 2023)
Leslie, Ian – Conflicted. How arguments are tearing us apart and how they can bring us together (Monatsliste März 2021)
Levy, Jonathan – Ages of Capitalism (Rezension Februar 2022)
Lewis, Michael – Erhöhtes Risiko (Monatsliste September 2019)
Lewis, Michael – Premonition (Monatsliste Mai 2021)
Lewitzky, Steven/Ziblatt, Daniel – Wie Demokratien sterben (Jahresliste 2018/19)
Lobo, Sascha/Lauer, Christopher – Aufstieg und Niedergang der Piratenpartei (Jahresliste 2014/15)
Lobo, Sascha – Die große Vertrauenskrise. Ein Bewältigungskompass (Rezension November 2023)
Lobo, Sascha – Realitätsschock (Monatsliste März 2020)
Löffler, Henner – Wie Enten hausen (Jahresliste 2017/18)
Luceno, James – Cataclyst (Monatsliste Januar 2020)
M
Maddow, Rachel – Drift. The unmooring of American military power (Jahresliste 2015/17)
Madigan, Tim – The Burning. Massacre, Destruction and the Tulsa Riot of 1921 (Monatsliste Juni 2020)
Malter, Stefan – OneNote für Einsteiger (Monatsliste September 2019)
Malter, Stefan – OneNote für Lehrer (Monatsliste September 2019)
Mann, Charles – 1493. Revisiting the world Columbus created (Monatsliste Mai 2020)
Manne, Kate – Down Girl. Die Logik der Misogynie. (Monatsliste Juni 2020)
Mannewitz, Tom/Thieme, Tom – Gegen das System. Linker Extremismus in Deutschland (Monatsliste November 2020)
Marr, Andrew – The making of Modern Britain (Monatsliste Januar 2020)
Marshall, Tim – Prisoners of Geography. Ten Maps That Explain You Everything About Global Politics (Rezension November 2022)
Martin, George R. R. – A Clash of Kings (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste September 2021)
Martin, George R. R. – A Dance with Dragons (Jahresliste 2018/19)
Martin, George R. R. – A Feast for Crows (Jahresliste 2018/19) (Monatsliste November 2021)
Martin, George R. R. – A Game of Thrones (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Juli 2021)
Martin, George R. R. – A Storm of Swords (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Oktober 2021)
Martin, George R. R. – Der Heckenritter. Das Urteil der Sieben (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste Oktober 2020)
Martin, George R. R. – Feuer und Blut (Monatsliste Oktober 2019)
Martin, George R. R. – The World of Ice and Fire (Jahresliste 2015/17) (Monatsliste November 2020)
Matyszak, Philip – Legionär in der römischen Armee (Jahresliste 2014/15) (Jahresliste 2015/17)
Mauch, Christoph/Patel, Kiran – Wettlauf um die Moderne. Die USA und Deutschland 1890 bis heute (Jahresliste 2018/19)
Mazower, Mark – Hitlers Imperium (Rezension März 2022)
Meinel, Florian – Vertrauensfrage. Zur Krise des Parlamentarismus (Monatsliste April 2020)
Middlekauf, Robert – The Glorious Cause. The American Revolution, 1763-1789 (Jahresliste 2015/17)
Möllers, Christoph – Das Grundgesetz (Rezension Juni 2023)
Möllers, Christoph/Schneider, Linda – Demokratiesicherung in der Europäischen Union (Monatsliste Juni 2020)
Moore, Alan – V for Vendetta (Rezension Dezember 2023)
Morrison, Grant – Supergods: What Masked Vigilantes, Miraculous Mutants, and a Sun God from Smallville Can Teach Us About Being Human (August 2022)
Mulder, Nicholas – The Economic Weapon (Rezension Februar 2022)
Munroe, Randall – How to (Monatsliste Januar 2020)
Munroe, Randall – What if (Jahresliste 2014/15)
Muuß-Merholz, Joran – Barcamp&Co (Monatsliste April 2020)
N
Neiberg, Michael – Potsdam. The end of World War II and the Remaking of Europe (Rezension April 2022)
Neiberg, Michael – When France Fell. The Vichy Crisis and the Fate of the Anglo-American Alliance (Rezension September 2023)
Nguyen-Kim, Mai Thi – Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit (Rezension Juni 2022)
Nonn, Christoph – Zwölf Tage und ein halbes Jahrhundert (Monatsliste April 2021)
Nichols, Tom – The Death of Expertise (Monatsliste Mai 2020)
O
Obama, Barack – A promised land (Monatsliste Dezember 2020)
Oermann, Nils-Ole/Wolff, Hans-Jürgen – Wirtschaftskriege (Monatsliste Juni 2020)
Orenstein, Peggy – Boys and sex (Monatsliste Februar 2020)
Orenstein, Peggy – Cinderella ate my daughter (Monatsliste Februar 2020)
Osterhammel, Jürgen – Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (Rezension Oktober 2023)
P
Parker, Joffrey – Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (Rezension März 2023)
Patterson, James T. – Grand expectations. The US, 1945-1974 (Jahresliste 2015/17)
Patterson, James T. – Restless giant. The US from Watergate to Bush v Gore (Jahresliste 2015/17)
Petrik, Andreas/Rappenglück, Stefan – Das Planspiel in der Politischen Bildung (Jahresliste 2018/19)
Pinker, Steven – Gewalt: Eine neue Geschichte der Menschheit (Jahresliste 2014/15)
Platt, Stephen – Imperial Twilight. The Opium War and the End of China’s Golden Age (Monatsliste Juni 2020)
Pötzl, Norbert – Der Treuhandkomplex (Monatsliste November 2021)
Pontzer, Herman – Burn (Monatsliste Juni 2021)
Pratt, Tim – The Fractured Void (Monatsliste Januar 2021)
Price, Roger – A concise history of France (Monatsliste Juli 2021)
Prize, Devon – Laziness Does Not Exist: A Defense of the Exhausted, Exploited, and Overworked (Rezension Dezember 2022)
Pullman, Philipp – Das Bernsteinteleskop (Monatsliste Januar 2020)
Pullman, Philipp – Das magische Messer (Monatsliste Januar 2020)
Pullman, Philipp – Der Goldene Kompass (Monatsliste Januar 2020)
Puschak, Evan – Escape into Meaning (September 2022)
Q
Quent, Michael – Deutschland rechtsaußen (Monatsliste November 2020)
Quiggin, John – Zombie Economics (Jahresliste 2013/14)
R
Raphael, Lutz – Jenseits von Kohle und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte nach dem Boom (Rezension Februar 2024)
Rauchway, Eric – Winter War. Hoover, Roosevelt and the first clash over the New Deal (Monatsliste August 2020)
Rehm, Scott – Game Angry. How to RPG the Angry Way (Jahresliste 2018/19) (Rezension Juni 2023)
Reichelt, Heiko/Wenge, Gerald – Klassenfahrten, Exkursionen, Wandertage (Monatsliste September 2019)
Rich, Nathaniel – Losing Earth (Rezension Jumi 2022)
Richter, Hedwig – Aufbruch in die Moderne (Monatsliste Mai 2021)
Richter, Hedwig – Demokratie. Eine deutsche Affäre (Rezension Januar 2022)
Richter, Hedwig – Frauenwahlrecht (Monatsliste Mai 2021)
Robinson, Kim Stanley – Roter Mars (Jahresliste 2014/15)
Robinson, Kim Stanley – The Ministry of the Future (Monatsliste März 2021) (Rezension November 2023)
Rosa, Don – Dagobert Duck. Sein Leben, seine Milliarden (Monatsliste November 2021)
Rostek, Andreas – Polska First. Über die polnische Krise (Jahresliste 2018/19)
Russel, Mark – The Flintstones (Monatsliste Mai 2021)
S
Sagan, Carl – Blauer Punkt im All (Jahresliste 2014/15)
Saini, Angela – Inferior. How science got women wrong (Jahresliste 2018/19)
Sandkühler, Thomas – Das Fußvolk der »Endlösung«. Nichtdeutsche Täter und die europäische Dimension des Völkermords. »Aktion Reinhardt«: die Rolle der »Trawniki-Männer« und ukrainischer Hilfspolizisten (August 2022)
Sarotte, Mary Elise – Not one inch. America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate (September 2022)
Schadlow, Nadia – War and the art of governance (Monatsliste November 2019)
Schaible, Jonas – Demokratie im Feuer (Rezension April 2023)
Scheidel, Walter – Escape from Rome (Monatsliste April 2020)
Schmoeckel, Reinhard/Kaiser, Bruno – Die vergessene Regierung: Die große Koalition 1966-1969 und ihre langfristigen Wirkungen (Rezension August 2022)
Schnerring, Almut/Verlan, Sascha – Die rosahellblau-Falle. Für eine Kindheit ohne Rollenklischees (Jahresliste 2018/19)
Schnerring, Almut/Verlan, Sascha – Equal Care. Über Fürsorge und Gesellschaft (Monatsliste Oktober 2020)
Schöllgen, Gregor – Krieg. 100 Jahre Weltgeschichte (Monatsliste Mai 2020)
Schürz, Martin – Überreichtum (Monatsliste Dezember 2020)
Schutzbach, Franziska – Die Erschöpfung der Frauen (Rezension Mai 2022)
Scurati, Antonio – M – Son of the Century (Rezension Mai 2022)
Sebestyen, Viktor – 1989 (Monatsliste Dezember 2021)
Seeck, Francis – Zugang verwehrt (Rezension Juni 2022)
Seemann, Michael – Die Macht der Plattformen (Rezension Mai 2022)
Seitz, Matt Stoller – Mad Men Carousel (Jahresliste 2015/17) (Rezension August 2023)
Sepinwall, Alan – Breaking Bad 101 (Jahresliste 2015/17)
Sepinwall, Alan/Stoller Seitz, Matt – The Sopranos Sessions (Jahresliste 2018/19)
Sepinwall, Alan/Stoller Seitz, Matt – TV – The Book (Rezension Oktober 2023)
Shanower, Eric – Age of Bronze (Rezension Dezember 2023)
Simms, Brendan/Laderman, Charlie – Hitler’s American Gamble (Rezension Juni 2022)
Simms, Brendan – Three victories and one defeat (Monatsliste Juni 2021)
Singer, P.W./Brooking, Emmerson – LikeWar: The Weaponization of Social Media (Jahresliste 2018/19)
Slobodian, Quinn – Globalisten (Monatsliste Mai 2021)
Smith, Jeff – Bone (Monatsliste Juli 2021)
Snyder, Timothy – Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin (Jahresliste 2018/19)
Soldatov, Andrei – The New Nobility: The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB (Oktober 2022)
Sorley, Lewis – A better war. The unexamined victories and final tragedy of America’s last years in Vietnam (Jahresliste 2018/19)
Spiegelmann, Art – Maus (Monatsliste April 2021) (Rezension Juli 2022)
Spinney, Laura – Die Welt im Fieber. Wie die Spanische Grippe die Welt veränderte (Jahresliste 2018/19)
Stahl, Bernhard – Internationale Politik verstehen. Eine Einführung (Monatsliste März 2020)
Stauss, Frank – Höllenritt Wahlkampf (Jahresliste 2013/14)
Stefanowitsch, Anatol – Eine Frage der Moral. Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen (Jahresliste 2018/19)
Steil, Benn – The Marshall-Plan. Dawn of the Cold War (Rezension Januar 2022)
Stöcker, Christian – Das Experiment sind wir (Rezension April 2022)
Stokowski, Margerete – We are feminists (Monatsliste Juli 2020)
Strausmann, Tobias – 1931. Debt, crisis and the rise of Hitler (Monatsliste September 2019)
Stritter, Mhaire – Kind des Goldenen Gottes (Pardona 1) (Monatsliste Oktober 2021)
Strobl, Thomas – Ohne Schulden läuft nichts (Jahresliste 2015/17)
Studwell, Joe – How Asia works (Jahresliste 2018/19)
Sullivan, Andrew – I was wrong (Jahresliste 2013/14)
T
Ther, Philipp – Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa (Monatsliste Oktober 2019)
Theweleit, Horst – Männerphantasien (Jahresliste 2018/19)
Thiele, Alexander – Der konstituierte Staat (Rezension Juli 2022)
Tierney, Joe/Baumeister, Roy – The power of bad. How the negativity effect rules us and what we can do about it (Monatsliste Januar 2020)
Tillmanns, Markus – Maraskengift (Monatsliste Januar 2020)
Toland, John – No Man’s Land. The last year of the Great War (Jahresliste 2018/19)
Tooze, Adam – Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben (Jahresliste 2018/19) (Monatsliste April 2021)
Tooze, Adam – Ökonomie der Zerstörung (Jahresliste 2013/14) (Monatsliste August 2021)
Tooze, Adam – Shutdown (Monatsliste September 2021)
Tooze, Adam – The Deluge. The Great War and the Remaking of the world (Jahresliste 2014/15) (Monatsliste Januar 2020)
Treichel, Hans-Ulrich – Der Verlorene (Monatsliste Oktober 2021)
U
–
V
Vasold, Manfred – Die Spanische Grippe (Rezension Juni 2023)
Venecia, Shlomo – Inside the Gas Chambers. Eight Months in the Sonderkommando of Auschwitz (Rezension Dezember 2023)
Vogel, Ezra M. – Deng Xioaping and the transformation of China (Juli 2022)
von Laak, Dirk – Alles im Fluss. Die Lebensadern unserer Gesellschaft (Monatsliste September 2019)
von Tricht, Jens – Warum Feminismus gut für Männer ist (Monatsliste September 2020)
W
Wahl, Johannes – Lektüreschlüssel zu Treichelts Verlorenem (Monatsliste Oktober 2021)
Wampfler, Philipp – Eine Schule ohne Noten (Monatsliste Dezember 2021)
Watterson, Bill – Calvin and Hobbes (Rezension März 2022)
Weeber, Karl-Wilhelm – Circus Maximums: Wagenrennen im antiken Rom (Rezension September 2023)
Wehler, Hans-Ulrich – Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1914-1949 (Monatsliste August 2020)
Wehler, Hans-Ulrich – Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1949-1990 (Monatsliste April 2020)
Weldon, Glen – The Caped Crusader. Batman and the rise of nerd culture (Monatsliste September 2019)
Wengst, Udo/Kentner, Herrmann – Das doppelte Deutschland. 40 Jahre Systemkonkurrenz (Monatsliste April 2020)
Wertheim, Stephen – Tomorrow, the world. The birth of US supremacy (Rezension Mai 2022)
White, Richard – The Republic for which it stands (Monatsliste Juli 2021)
Will, Wolfgang – Alexander der Große. Geschichte und Legende (Rezension Dezember 2023)
Wilkerson, Isabel – Caste. The lies that divide us (Rezension März 2022)
Williamson, Gordon – U-Boat tactics in the Second World War (Monatsliste Februar 2020)
Wilson, James Graham – The triumph of improvisation (Jahresliste 2018/19)
Wilson, Peter H. – Blood and Iron. A military history of the German speaking peoples since 1500 (Rezension November 2022)
Wilson, Peter H. – Heart of Europe (Jahresliste 2018/19)
Wilson, Rick – Everyting Trump touches dies (Jahresliste 2018/19)
Wilson, Robert H. – LBJ’s neglected legacy (Jahresliste 2017/18)
Winkler, Ralf – Grundkurs Bouldern (Rezension Juni 2023)
Winkler, Ralf – Taping im Klettersport (Rezension Juni 2023)
Wood, Gordon S. – Empire of Liberty. A history of the early American Republic (Jahresliste 2015/17)
Wüpper, Thomas – Bestriebsstörung (Monatsliste Januar 2021)
X
–
Y
Yüzel, Deniz – Und morgen die ganze Türkei. Der lange Aufstieg des Recep Tayyip Erdogan (Monatsliste Februar 2020)
Z
Zadoff, Noam – Geschichte Israels (Monatsliste Juli 2021)
Zelikow, Philip – The road less travelled (Monatsliste April 2021)
Zinn, Howard – A people’s history of the United States 1492 to present (Jahresliste 2018/19)
Zubok, Vladimir – A Failed Empire (Monatsliste Juli 2021)
Zubok, Vladimir – Collapse. The Fall of the Soviet Union (Rezension April 2022)
Zeitschriften
Aus Politik und Zeitgeschichte – 150 Jahre Reichsgründung (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – 1848/49 (Rezension August 2023)
Aus Politik und Zeitgeschichte – 9/11 (Monatsliste August 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – (Anti-)Rassismus (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Äthiopien (Monatsliste Juni 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Bevölkerungsschutz (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Care-Arbeit (Monatsliste April 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Chinakompetenz (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Corona (Monatsliste September 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Das andere Geschlecht (Monatsliste Februar 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Deutsche Außenpolitik (Rezension Juli 2023)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Deutsche Einheit (Monatsliste August 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Europäische Baustellen (Monatsliste Juni 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Fleisch (Rezension Januar 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Freie Rede (Monatsliste März 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Gefängnis (Monatsliste November 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Geldpolitik (August 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Generationen (Monatsliste Januar 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Geschichte und Erinnerung (Monatsliste November 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Geschlechtergerechte Sprache (Rezension April 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Gleichwertige Lebensverhältnisse (Monatsliste Januar 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Green New Deals (Rezension März 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Jugend und Protest (Monatsliste Oktober 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Iran (Monatsliste Juni 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Kinder und Politik (August 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Klimadiskurse (Monatsliste Februar 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Militär (Monatsliste April 2020, Monatsliste September 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Parlamentarismus (Monatsliste September 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Politische Bildung (Monatsliste April 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Rausch und Drogen (Monatsliste Dezember 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Rechtsterrorismus (Monatsliste Februar 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Rente (Rezension Juli 2022)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Sowjetunion (Monatsliste Mai 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Schwarze Null (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Stuttgart (Monatsliste März 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – USA (Monatsliste Mai 2021)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Wetter (Monatsliste Februar 2020)
Aus Politik und Zeitgeschichte – Wir schaffen das (Monatsliste August 2020)
Deutschland und Europa – Die EU und ihre Grenzen
Deutschland und Europa – Nachkriegsjahre
GEO Epoche – Das Goldene Zeitalter der Niederlande
GEO Epoche – Denker, Forscher, Pioniere
GEO Epoche – Die Welt seit dem Jahr 1
GEO Epoche – Rom und die Germanen
GEO Epoche – Verbrechen der Vergangenheit
Informationen zur politischen Bildung – Europäische Union
Informationen zur politischen Bildung – Geschlechterdemokratie
Informationen zur politischen Bildung – Ländliche Räume
Informationen zur politischen Bildung – Parlamentarismus
Informationen zur politischen Bildung – Weimar

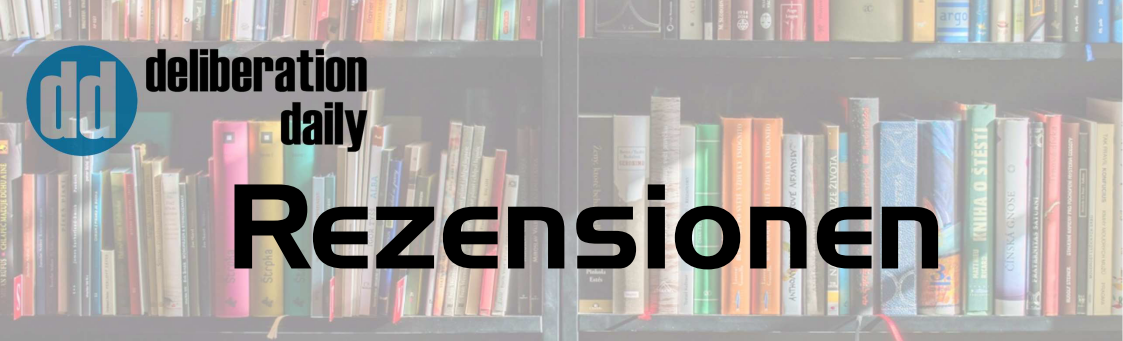

Interessant die (Fehl?)Einschätzung von China bei „Why Nations fall“ auch bei dir noch 2013. Das Regime scheint alle Theorieansätze zu sprengen.
Noch. Das wurde jahrelang auch über die sowjetische Wirtschaft gesagt.
Ich weiß. Aber die Sowjets hielten an der Planwirtschaft fest, aus ideologischer Starre. Die Chinesen sind dagegen völlig unideologisch: Raubtier-Kapitalismus mit einer Einparteien-Herrschaft einer „kommunistischen“ Partei zu kombinieren, das hatte kein Theoretiker auf dem Schirm.
Die ticken irgendwie sehr anders. Bei aller Kontrolle und Unterdrückung: Wenn das Häuschen einer Oma dem Autobahnbau im Wege steht, wird die nicht zwangsenteignet, sondern die Autobahn mit großem Aufwand drum herum gebaut. Andererseits werden ganze Stadtviertel platt gemacht. Mit den gängigen Theorie-Werkzeugen sind die Chinesen nicht zu packen.
Sie übersehen mehreres. China hat zwar ein reines kapitalistisches Wirtschaftssystem installiert, das die Effizienz in Reinkultur entfaltet. Der wesentliche Haken ist jedoch: das System ist anders als freie Systeme nicht innovativ. Das Wesen von Kapitalismus ist nicht nur brutale Effizienz, sondern auch Innovationskraft und hohe Anpassungsfähigkeit.
Doch Chinas Wirtschaft hat den Aufholprozess vor allem nur ein hemmungsloses Copy&Paste-System gepaart mit einer dramatisch gestiegenen Verschuldung bewältigt. Jede Technologie, in der das Reich der Mitte eine wesentliche Marktposition übernommen hat, verdankt sie ausländischem Wissen. Die Geschäftsmodelle von Amazon, Facebook und Apple wurden einfach übernommen. Das Automobil ist uralt. So geht es weiter.
China tat dies unter Bruch internationaler Konventionen und mit einer Zielstrebigkeit, die wir hier „kriminelle Energie“ nennen würden. Der Westen duldete dies bisher, weil China einen riesigen Markt verspricht. Doch ein hoher Anteil der Menschen sind immer noch bitter arm, viele ausgebeutet. Dies müsste sich ändern, damit die Theorie tatsächlich widerlegt würde. Die Chancen dafür stehen nicht nur wegen dem politischen System außerordentlich schlecht. Denn das System hat auch mit der Ein-Kind-Politik dafür gesorgt, dass die Bevölkerung des Landes zu der am schnellsten alternden der Welt gehört. Doch das führt zur Gleichung Alte Bevölkerung = Innovationsfeindlichkeit. Alte Menschen sind nicht innovativ, machen keine Erfindungen, versuchen Neues zu vermeiden statt Veränderungen voranzutreiben.
China wird aufgrund der 1,4 Milliarden Einwohner ein gewichtiger Teil der Weltpolitik sein. Aber der Aufholprozess wäre noch sehr lang, damit er gelingen soll. Derzeit liegt das chinesische Pro-Kopf-Einkommen bei 8.300 US-$ bei extrem großer Ungleichheit. Zum Vergleich: in der EU liegt dieser Wert bei 35.644 US-$, die USA liegen sogar bei 56.721 US-$. Das europäische Medianeinkommen beträgt immer noch doppelt so viel wie der Durchschnitt in China.
Die USA haben jedoch nicht das Handicap einer alternden Bevölkerung. Die europäische altert zwar auch schnell, kann aber immerhin auf Zuwanderung junger Menschen vom afrikanischen Kontinent wie aus dem Nahen Osten bauen. Wie ertragreich dies sein kann, lässt sich in Israel bewundern, das ein echter Motor an Innovationskraft ist. Um das zu illustrieren: China hat einen „Patentindex“ von 146,28, Deutschland liegt bei 598,42, die USA gar bei 746,49. Die Geduld mit China, gegen die Regeln zu spielen und seinen Wohlstand mit westlichen Erfindungen zu bauen, geht zur Neige.
Oder anders ausgedrückt: Mit Klauen wird niemand auf Dauer reich.
Pfeifen im Keller?“Unrecht Gut gedeiht nicht“, habe ich auch gelernt als Kind. Ein Märchen. Die russischen Oligarchen und die Rockefellers wurden auch „durch Klauen reich“.
Auch die Deutschen im 19. Jahrhundert, durch Industriespionage bei den Briten. Darauf bauten sie dann , in einem autoritären System, eine innovative Wirtschaft auf. Das könnte den Chinesen auch gelingen. Bei Supercomputern und Weltraumtechnik sind sie schon vorne dabei.
Ja, China handelt unfair, teils kriminell, rücksichtslos den eigenen Vorteil verfolgend. Darüber hinaus wirkt die schiere Masse. Und strategische Planung: Neue Seidenstraße, Häfen, Rohstoffe und Seltene Erden, Hilfe für westliche Staaten, die von ihresgleichen im Stich gelassen wurden wie Griechenland und Italien, Export von „Sicherheitstechnik“ zur Herrschaftssicherung usw.
Sie führen das 19. Jahrhundert und eine dysfunktionale Wirtschaft an. Das passt nicht. Rockefeller baute ein Monopol wie die russischen Oligarchen auch (daher der Name). So etwas funktioniert nicht und schafft auf Dauer eben keinen Wohlstand. Genau das hat Why Nations Fail – Warum Nationen scheitern deutlich aufgezeigt. Ihr Argument war, zur Erinnerung, dass die chinesische Entwicklung gegen alle Regeln verlaufe, eben auch die Theorie von Daron Acemoğlu und James A. Robinson widerlege.
Weder Deutschland noch Russland haben in Ihren Beispielen dauerhaften volkswirtschaftlichen Wohlstand geschaffen.
Die Theorie von „Why Nations Fail“ ist ja gerade, dass in unterentwickelten Volkswirtschaften (check) mit extraktiven Methoden (check) erstaunliches Wachstum möglich ist (check), aber eben kein nachhaltiges (to be determined). Möglich, dass das chinesische System sich als wettbewerbsfähig und innovativ genug zeigt. Ich bin allerdings skeptisch, unter anderem aus den von Stefan genannten Gründen.
Deutschland stieg während des Kaiserreichs zur stärksten Wirtschaftsmacht Europas auf, in Wissenschaft und Technik führend noch bis in die 20er Jahre. Internationale Wissenschaftssprache war Deutsch. Trotz Obrigkeitsstaat und Untertanengesinnung.
Was aus Russland mit Gorbatschow geworden wäre, wissen wir nicht. Unwahrscheinlich aber, dass dieses Oligarchensystem entstanden wäre mit extremer Ungleichheit, erfolgreich nur in Nischen (Waffen, Kosmos), sonst nur auf Rohstoffen aufgebaut.
Die deutschen Exporteure starren auf die Wachstumsraten in China wie das Kaninchen auf die Schlange, die Regierung traut sich kaum ein wirklich kritisches Wort. China will bis zum 100. Jahrestag 2049 unabhängig sein vom ausländischem Wissen und Technologie, in allen Bereichen. Bisher wurde Know How gekauft oder geklaut, das ist bald nicht mehr nötig. Ich sehe keine Anzeichen für einen Niedergang. Bei den Umweltproblemen wird bereits entgegengesteuert. Vielleicht wird die Alterspyramide den weiteren Aufstieg bremsen?
Jetzt haben Sie gerade mal einen Purzelbaum geschlagen. Einerseits behaupten Sie, Deutschland habe im 19. Jahrhundert sein Wissen geklaut, andererseits es sei innovativ gewesen.
Solche 200 Jahrespläne hatten die Sowjets auch, ebenso Honecker. Das gehört zu jeder Diktatur. Üblicherweise beschreiben solche Pläne nur die eigene Großartigkeit. Die Wirklichkeit richtet sich nicht nach Plänen, das kapitalistische System schon gar nicht.
Wenn China mal die erste wesentliche wirtschaftliche Neuerung der Welt beschert hat, gäbe es mindestens mal ein Indiz für Innovation. Aber nochmal: das Riesenreich lebt eben davon, von seiner Größe. Nur benötigt Kreativität Freiheit im Denken und Probieren. Beides ist in Diktaturen nicht möglich. Die Pläne beschreiben nur die geistige Armut.
Sie haben es an Deutschland im 19. Jahrhundert beschrieben: Aufsteigernationen sind ein Quell an Neuerungen und Innovationen. Übrigens wie bei Unternehmen. Eigentlich müsste China folglich top bei Patentanmeldungen sein. Sind sie aber nicht, die Nachfolger Den Xiaopings fallen total ab. Korea, nicht so weit von China gelegen, pulvert pro Kopf nur so Ideen raus, Taiwan übrigens ebenso. Tatsächlich herrscht in Peking und Shanghai geistige Armut.
https://de.wikipedia.org/wiki/Patentindex
Das hat mit dem System zu tun. Wie Stefan bereits anführte, das schnelle Wachstum über ein paar Dekaden hatte selbst die Sowjetunion vorzuweisen. Anhand dieses Beispiels lässt sich am Besten zeigen, was Nachhaltigkeit bedeutet.
Auf Chinas Innovationsunfähigkeit würde ich mich nicht verlassen. Als in den USA nach Clinton die Forschungsbudgets schwanden, zog es selbst die an den amerikanischen Eliteuniversitäten ausgebildeten Chinesen zunehmend zurück in ihre Heimat. Das ganze verstärkte sich, als die Wissenschaft unter Obama mit dem Sequester ausgepresst wurde. Und Trumps offene Ausländerfeindlichkeit im Allgemeinen, sowie seine Chinafeindlichkeit im Besonderen haben noch mehr Chinesen vertrieben. Viele haben auch ihre Visa nicht erneuern können, so dass selbst ein großer Teil derer heim musste, die vielleicht gern geblieben wären. Zeitgleich lockten Chinas aus dem Boden gestampften Forschungsinstitutionen mit Trauminvestitionen, Fördermitteln in fast beliebiger Höhe, Arbeitsgruppengrößen und Mitarbeiterzahlen gut doppelt und dreifach so hoch wie in den USA und hohen Gehältern. Ich kenne einige Topleute, die nicht widerstehen konnten.
Heute zahlen sich alle diese Investitionen aus. Chinas Anteil an Forschungspublikationen wächst praktisch in jedem Segment inklusive der Spitzenforschung. Gut möglich, dass die Chinesen in ihrem unfreien Land ohne freie Gedanken keine vernünftige Folgegeneration an Wissenschaftlern, Tüftlern und Ingenieuren hinbekommen. Aber eine vernünftige Gründergeneration haben sie allemal. Und die Folgegeneration wird erst in 20 Jahren ein mögliches Problem.
Aus Know-how entsteht noch längst nicht Innovation. Dazu gehört Kreativität und Kreativität gedeiht nicht unter Zwang, Druck und Stress. Sie können hochintelligent und top-ausgebildet sein und sitzen 12 Stunden am Schreibtisch, während Ihnen nichts einfällt.
Kennen Sie das nicht? Meine besten Ideen und Einfälle, echte Kreativität, habe ich nicht im Büro und nicht, wenn ich mir etwas Konkretes vornehme. Der beste Kommentar, den ich je geschrieben habe, ist mir in der Konzeption im Fitnessstudio zum Metzger-Blog eingefallen, originell und mit Esprit.
Unternehmen wie Google, Facebook und Apple wissen das längst und lassen ihre Kreativen werkeln, wo es ihnen gefällt. Unternehmen und Staaten können kluge Menschen heuern, dass sie im Gegenzug dafür kluge Entwicklungen bekommen, ist damit noch lange nicht ausgemacht.
Das Problem Chinas ist nicht, keine klugen, sehr gut gebildeten Menschen zu besitzen. Das sind immerhin 1,4 Milliarden, ein paar kluge Köpfe werden da schon statistisch darunter sein. Aber es kommt auf die Bedingungen an. Europa hat sich von 700 bis 1700 n.Chr. praktisch nicht entwickelt nur um sich danach rasant zu entwickeln. Auch Arabien hat viele kluge Köpfe, aber sie sind gefangen in mittelalterlichen archaischen Strukturen, Denkweisen und Lebensvorstellungen.
Wenn ich wählen müsste, eher in amerikanische oder chinesische Technologieunternehmen zu investieren, wäre die Entscheidung absolut klar.
Die Wissenschaftler in China stehen meines Wissens nach nicht unter Druck, Zwang und Stress. Zum Vergleich: Ein Bekannter von mir forschte in der Türkei und bekam Morddrohungen bis er schließlich das Land verlassen musste, weil er nicht die Ergebnisse lieferte, die zur Parteiideologie von Herrn Erdogan passten. Auch die Sowjetunion hat früher versucht, die Natur im Politbüro zu diktieren und die Wissenschaft musste dann die Ergebnisse liefern, die zur Propaganda passten. Nichts Vergleichbares habe ich je aus China gehört. Wenn überhaupt haben viele Wissenschaftler dort mehr Freiheiten als etwa in den USA, weil sich der Staat nicht in die Forschung einmischt, aber mit seinen enormen Investitionen langfristig und planbar die Stellen der Laborleiter und Mitarbeiter absichert. In den USA hingegen sinkt mit der Inflation die nie angepasste Forschungsförderung von Jahr zu Jahr und gerade junge Wissenschaftler sitzen permanent mit wenig Planbarkeit auf einem Schleudersitz. Der Trend geht hin zu mehr prekären Stellen.
Social Scoring erzeugt keinen Stress?
Sie machen einen grundsätzlichen Fehler bei der Frage, was Innovation ausmacht. Sie denken in (Groß-) Konzernstrukturen. Doch die besten Ideen der letzten 30 Jahre sind nicht in Big Companies entstanden. Wer in den USA eine innovative Idee und ein Konzept hat, kommt sehr schnell an (Risiko-) Kapital, um diese zu verwirklichen. Google, Facebook, WhatsApp, Tesla, PayPal sind so entstanden. Nicht GM hat allein auf Elektromobilität in einem vom Öl faszinierten Land gesetzt, es war ein Südafrikaner. Nicht IBM hat ein marktbeherrschendes Betriebssystem für Personalcomputer entwickelt, sondern ein Tüftler mit Unternehmergeist.
CureVec, das Biotech-Unternehmen, das nun in aller Munde ist, ist klein, gerade mal 18 Millionen machen die Tübinger an Umsatz. Das Unternehmen wird bisher allein mit Risikokapital betrieben, fast 400 Millionen Euro setzten die privaten Investoren bisher in den Sand.
Und Geld und Kapital allein wiederum gewährleisten nicht eine innovative Gesellschaft. Es kommt eben auf die sehr komplizierte Mischung an.
Ich möchte Ihnen garnicht grundsätzlich widersprechen. Gebe aber zu bedenken, dass die meisten gerade sehr hoch innovativen Unternehmen – zumindest in der Biotech-Branche – Auskopplungen von den Universitäten darstellen. CureVac ist ein Beispiel. BioNTech oder Immatics wären andere. Die kommen praktisch aus dem öffentlichen Forschungssystem und die leitenden Köpfe sind die, die die grundlegenden Konzepte, auf denen das Unternehmen fußt, in ihren Arbeitsgruppen in den jeweiligen Instituten entwickelt haben. Was die in erster Linie brauchen, sind Kapital und fleißige Hände, die viel und hart arbeiten. In China gibt es beides.
Die Frage ist eher, ob China langfristig an unabhängig denkende Köpfe kommen wird. Die wurden bisher zumeist in den USA ausgebildet, was möglicherweise zu Ende geht. Viele sind auch an europäischen Universitäten. Das sehe ich derzeit nicht zu Ende gehen. Aber ob der Bedarf an Top-Denkern für China langfristig gedeckt werden kann mit den gegenwärtigen Mitteln, ist unklar. Und die chinesischen Universitäten selbst erziehen eher Ja-Sager, die sich unterordnen. Das jedoch ist ein Zukunftsproblem, nicht ein Problem der Gegenwart.
Und das Social Scoring ist weniger ein berufliches Problem als ein gesellschaftliches Problem. Ich nehme an, die Menschen gewöhnen sich einfach dran. Dass dadurch die Leistungsfähigkeit sinkt, halte ich nicht für erwiesen.
Gerade an Ihrem Beispiel lässt sich erkennen, dass Prosperität eine hochkomplexe Sache ist. Forschung, Wissen und Erkenntnisgewinn bedingen es nicht allein. Ohne Unternehmertum werden Ideen nicht zur Marktreife gebracht. Nun, Unternehmertum gibt es zweifellos auch unter Chinesen. Doch gibt es die Verzahnung, wie sie in Europa und Nordamerika existiert? Und: freies Unternehmertum, im Extrem zu Korruption und Monopolisierung wie beispielsweise in Russland getrieben, führt zu extremer Ungleichheit und gesellschaftlicher Unzufriedenheit. Das wiederum wirkt ab einem bestimmten Stadium absolut entwicklungshemmend.
Europa und Nordamerika haben daraus früh gelernt, Antimonopolgesetze angeschoben, soziale Sicherungsmodelle entwickelt. Demokratie ist dabei am besten geeignet, den sozialen Ausgleich in einer Gesellschaft zu verhandeln, wobei die Antworten je nach Mentalität in angelsächsischen, skandinavischen und kontinentaleuropäischen Ländern höchst unterschiedlich ausfällt. Eine Zentralmacht kann dies nicht leisten, schon gar nicht für 1,4 Milliarden Menschen auf einmal.
Ich bezweifle jedoch stark, ob der durch Trump ausgelöste Brain Drain nachhaltig ist. Die USA haben weiterhin die besten ökonomischen und strukturellen Rahmenbedingungen für Forschung und Unternehmertum. In der jetzt verursachten Abschreckung liegt eine Chance für die Europäer, aber sie werden sie wahrscheinlich nicht zu nutzen wissen. Denn wer bisher in die USA gegangen ist, tat dies, weil er die große Freiheit zu schätzen wusste. Unternehmerische Freiheit und Freiheit der Forschung ist jedoch nicht das, was in Teilen der EU groß geschrieben wird. Länder wie Italien und Griechenland, aber auch Spanien gewähren relativ wenig Rechtsschutz, eine absolute Determinante von Unternehmertum. Ideologie hält Einzug in der Wissenschaft und den Universitäten. Europa muss sich ändern, um diese jungen Menschen dauerhaft zu gewinnen und einen wesentlichen Teil des weltweiten Risikokapitals zu attrahieren. Bisher sind keine Anzeichen zu erkennen, dass dies verstanden wurde.
Ich bin ganz bei Ihnen, was Korruption und Monopolbildung angeht und welch negativen Einfluss solche Prozesse auf das Unternehmertum haben können. Ich bin nur ein ganzes Stück vorsichtiger als Sie. Einen Staat wie China, mit diesem sehr speziellen Modell, gab es noch nie. Und da ist es einfach schwierig die Zukunft abzuschätzen. Das chinesische Modell kommt nämlich nicht nur mit Nachteilen, sondern auch mit Vorteilen, darunter etwa die hohen Staatsinvestitionen in Forschung und ein System, das sehr fleißige, sehr hart arbeitende junge Menschen produziert, die man eben auch braucht, wenn man erfolgreich sein will …
Ich bezweifle jedoch stark, ob der durch Trump ausgelöste Brain Drain nachhaltig ist.
Ich glaube, dass es ein Fehler ist hier nur Donald Trump zu sehen. Die USA haben schon unter Obama massiv an Attraktivität als Forschungsstandort verloren. Ich selbst kenne persönlich mehrere Wissenschaftler, die zwischen 2008 und 2015 infolge der kollabierenden Forschungsförderung aus den Universitäten gedrängt wurden. Ein befreundeter Assistant Professor an einer amerikanischen Eliteuniversität wurde z.B. entlassen, weil er trotz großer Erfolge in einem unmöglichen Förderungsumfeld keinen Grant an Land ziehen konnte. Dieser Wissenschaftler ging dann nach China, wo ihm ein Labor mit 20-30 Mitarbeitern und praktisch unbegrenzten Mitteln zur Verfügung gestellt wurde. Ein weiterer festangestellter Professor an derselben Universität ging zurück nach China, obwohl er bereits lange Zeit mit seiner Familie in den USA gelebt hatte, weil das Angebot, das er bekam einfach zu attraktiv war. Ein dritter Professor an derselben Universität blieb zwar mit einem Bein in den USA, nahm aber eine Doppelfunktion wahr, im Rahmen derer er ein neu gegründetes Mega-Institut in China leitete. Und diese Beispiele häufen sich.
Mittlerweile kenne ich bereits mehrere Europäer, die den Schritt nach China gemacht haben und dort Forschungsgruppen gegründet haben, weil sie in Europa keinen Universitätsjob bekamen. Und viele europäische Universitäten haben Kooperationen mit chinesischen Institutionen aus der Taufe gehoben und bilden dort jetzt die Studenten nach einem „europäischen“ Modell aus. Wie mir der Leiter eines solchen Projekts persönlich mitteilte, geht es da in erster Linie darum, die Studenten zu unabhängigem Denken zu erziehen und ihnen die „hierarchischen Denkstrukturen“ abzugewöhnen. Wie erfolgreich das ist, kann ich nicht sagen. Aber diese Prozesse laufen halt …
Es war im Jahr 2015 oder 2017, also möglicherweise sogar noch vor Trump, als ich bei einer wissenschaftlichen Konferenz an einem Karriere-Workshop teilnahm. Ich wollte erst nicht hingehen, denn gewöhnlich hat man alle gesehen, wenn man einen gesehen hat. Meist drehen sich alle Fragen darum, wie man eine Professur an einer Universität ergattert. Aber diesmal war ich wirklich geschockt. Eine Stunde lang bombardierten Postdocs und Doktoranden die eingeladenen Wissenschaftlern mit Fragen zu Forschungsmöglichkeiten in Europa. Wie kann man nach Europa ziehen? Welche europäischen Länder sind am besten für eine Karriere geeignet? Wie ist die Visa-Situation in der EU für Chinesen und Inder? Wieviel wird in Europa in die akademische Forschung investiert? Haben ausländische Wissenschaftler, die in Europa forschen, eine Perspektive langfristig zu bleiben? So ging das in einem fort. Eine Stunde lang. Ich kam aus dieser Veranstaltung nicht mit dem Gefühl heraus, dass die USA als besonders attraktiver Forschungsstandort wahrgenommen wurden …
Die Konferenz war übrigens in den USA.
Und dann kam Trump. Trump hat selbstverständlich direkt die Lage ausländischer Wissenschaftler verschlechtert, z.B. indem er Visaprozesse verzögerte. Er hat den Ruf der amerikanischen Wissenschaft massiv beeinträchtigt und die Wissenschaft dramatisch polarisiert. In Feldern wie der Klimaforschung oder der Immunologie gibt es heutzutage keinen Konsens der Fakten mehr, sondern eine Spaltung zwischen Realisten auf der einen und Republikanern auf der anderen Seite. Die ständigen Attacken auf die Wissenschaft und die Versuche die Förderung für die Wissenschaft weiter zu verknappen und teilweise eben auch unter staatliche Aufsicht zu stellen, werden einen sehr nachhaltigen Effekt auf den Ruf amerikanischer Forschung haben, auch wenn viele dieser Versuche dank des US-Kongresses letztlich ins Leere liefen.
Aber es sind eben nicht nur diese direkten Attacken auf die Wissenschaft unter Trump. Trump hat praktisch unmittelbar mit seinem Amtsantritt die Stimmung im Land dramatisch verändert. Das kann und konnte jeder fühlen, der damals in den USA gelebt hat. Berichte mehren sich etwa, dass Asiaten auf der Straße angespuckt, beschimpft oder geschlagen werden. Das betrifft natürlich nur eine Minderheit unmittelbar, aber eine Mehrheit von Asiaten liest diese Berichte. Manche davon gehören zu den klügsten Köpfen in dieser Welt und würden auch anderswo einen guten Job finden. Ich kenne mindestens einen Fall eines festangestellten Professors derselben Eliteuniversität, die ich oben bereits erwähnt hatte, der explizit wegen Trump seine Stelle gekündigt hat und nach Europa gezogen ist. Mehrere meiner Bekannten in den USA, die asiatischen Ursprungs sind, spielen mit dem Gedanken das Land zu verlassen. Eine andere Bekannte, diesmal eine ohne Einwanderungshintergrund, also eine „Bio-Amerikanerin“, emigrierte letzten Monat nach Europa. Ich war erstaunt und fragte warum. Die Antwort war nur ein Wort: „Trump“.
All das ist natürlich in gewisser Weise anekdotisch und es ist immer gefährlich von seinem eigenen Umfeld auf die Gesamtsituation zu schließen. Aber dass die vergangenen Jahre, von Obama bis Trump allesamt verlorene Jahre für die amerikanische Forschung, keinen Effekt haben werden auf den zukünftigen Erfolg von US-Universitäten Personal anzuwerben, halte ich für unwahrscheinlich.
Natürlich wird es immer Chinesen und Inder geben, die gerne in die USA ziehen würden. Aber die Frage ist, welche Entscheidungen die Spitzenleute treffen werden. Die besten der Besten. Die gingen bisher fast ausschließlich in die USA. Eine Minderheit ging nach Kanada und Großbritannien. Und Deutschland z.B. bekam bestenfalls die dritte oder vierte Reihe. In China und Indien selbst gab es praktisch gar keine Perspektiven.
Heute gibt es in China absolute Top-Institutionen, die mit Harvard und Yale problemlos mithalten können. Die EU winkt mit Investitionen in ihren Forschungsstandort und einem Ausbau der internationalen Netzwerke. Und die USA … naja, … die USA tun gerade alles, was sie können, um ausländische Talente zu vertreiben …
Übrigens, ich kenne mich mit China kaum aus. Wenn einer von euch zwei (oder beide) einen Erklärartikel schreiben wollen zu dem Thema fände ich das topp! Vielleicht ein „China ist innovativ, Pro und Contra“ oder so.
Ihre Darstellungen sind plausibel und decken sich mit meinen Beobachtungen. Ich selbst war seit fast 10 Jahren nicht mehr drüben, was im wesentlichen mit den kulturellen Veränderungen zu tun hat. Auch beobachte ich einen Rückzug amerikanischer Unternehmen vom europäischen Markt.
Der entscheidende Bug liegt woanders. Staatliche Investitionen sind Anschubfinanzierungen. Sie sind nicht nachhaltig, wenn sie nicht von privaten unternehmerischen Initiativen flankiert werden. Der Staat wie auch die wissenschaftliche Forschung wissen nunmal nicht, wo Marktchancen liegen und wie man Wissen zu Produktreife bringt. Wir werden nicht müde zu bemühen, welche Erfindungen von deutschen Forschungsinstituten gemacht wurden: Fax, mp3, Magnetschwebebahn, Internet.
Mich erinnert vieles an China an den Aufstieg Japans in den Sechziger bis Achtzigerjahre. Auch die japanische Industrie gelang der Aufstieg mit immer besseren, aber auch günstigen Plagiaten westlicher Erfindungen. Nippon kaufte westliche Unternehmen mit dem Know-how, zog Spitzenforschung an. Als dann das Wachstum erst anfing zu schwächeln, der Strukturwandel stockte, pumpte die Regierung die Verschuldung auf und arbeitete mit Zinssenkungen. Auch der Yen stand immer wieder im Verdacht, unterbewertet zu sein.
Japan ist die Transformation von Wissen in innovative Produkte nicht wirklich gelungen. Es braucht offensichtlich ein Klima, Forschung und Unternehmertum ideal zu verzahnen. In Israel gelingt dies nahezu optimal. Doch die israelische Gesellschaft in Tel Aviv und Haifa ist enorm liberal, weltoffen, beeinflusst von vielen Kulturen und Denkrichtungen und dazu pragmatisch angelegt.
Dennoch haben die USA weiterhin nahezu idealtypische Voraussetzungen. In den letzten 15 Jahren traten sicher Schwächen hervor, diese sind aber nicht struktureller Natur wie in China, sondern Ausweis der amerikanischen Orientierungssuche. Ich sehe das Land durch die nationale Tragödie von vor fast 20 Jahren in den Grundfesten erschüttert. Aber die USA haben ihre Anpassungsfähigkeit immer wieder bewiesen.
„Kreativität gedeiht nicht unter Zwang, Druck und Stress“
In toto sicher richtig, aber Ausnahmen bestätigen auch diese Regel. Und die können entscheidend sein. Selbst in der Nazi-Diktatur gab es mindestens zwei bahnbrechende Innovationen: Der Jet-Antrieb und die Raketentechnik. Die USA haben beides übernommen und erfolgreich weiter entwickelt. Die Ergebnisse von Kreativiät können übertragen werden.
Wie man hört und liest, wird an chinesischen Schulen und Hochschulen gepaukt und nicht zu selbständigem Denken erzogen. Müsste der Theorie nach mittelfristig zu wirtschaftlichem Misserfolg führen, tut es aber bisher nicht.
Die These, dass politische Freiheit und wirtschaftliche Prospertiät Hand in Hand gehen, wurde aus der europäischen Geschichte abgeleitet: Wirtschaftlich erfolgreiche Bürger, Handwerker und Kaufleute, haben den Stadtherren Freiheiten abgetrotzt, später den Feudalherren. Man konnte also annehmen, dass auch in China eine Mittelschicht entstehen und den Machthabern Mitentscheidungsrechte abringen würden. Das ist bisher nicht eingetreten – im Gegenteil. Der Unterdrückungs- und Überwachungsstaat wird weiter ausgebaut – der wirtschaftliche Erfolg und damit die Basis für die Weltmacht ist trotzdem da.
Die westliche Idee der Menschen- und Bürgerrechte verliert im asiatischen Raum zunehmend an Rückhalt, u. a. auch wegen des „Chinesischen Erfolgsmodells“. Ob das wirklich auf Sand gebaut ist und bald wie ein Kartenhaus zusammenbrechen wird? Ich bin da skeptisch.
Welcher wirtschaftliche Erfolg?
Laut Planvorgaben wird China dieses Jahr wundersamer Weise trotz Corona ein Wachstum von 6,5% erzielen. Doch Ökonomen haben an den zahlen aus dem Reich der Mitte längst ihre Zweifel. Bereits 2017 schrieb der SPIEGEL:
Ist Chinas Wachstum zwischenzeitlich eingebrochen?
Genau das meinen unabhängige Ökonomen. „Wir haben große Schwankungen der Wirtschaftsentwicklung beobachtet“, sagt Mark Williams, Asien-Chef beim Londoner Forschungshaus Capital Economics. Zeitweise habe das Wachstum stark nachgelassen, denn China baut seine Wirtschaft grundlegend um. Weg von der Schwerindustrie und Billigprodukten. Hin zu Dienstleistungen und höherwertigen Waren. (..).
„Die neuen Wachstumstreiber reichen bei Weitem noch nicht, um 6,5 oder sieben Prozent zu erreichen“, sagt Max Zenglein, Ökonom des Mercator Institute for China Studies (Merics) aus Berlin. „Daher pumpt die Regierung gerade wieder viel Geld in die Old Economy und den Aufbau von Infrastruktur.“ Während private Investitionen in den Keller gehen, fließen staatliche Milliarden in neue Flughäfen, Hochgeschwindigkeitseisenbahnnetze, Autobahnen – auch wenn China vielerorts davon schon mehr als genug hat. „Nachhaltig ist das nicht“, sagt Zenglein. Aber es belebt kurzfristig die Konjunktur.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/china-und-das-wirtschaftswachstum-ist-die-statistik-frisiert-a-1130673.html#:~:text=Denn%206%2C7%20Prozent%20j%C3%A4hrliches%20Wachstum%20hat%20Chinas%20Statistikbeh%C3%B6rde,dem%20zweiten%20Quartal%2C%20nach%20dem%20dritten%20Quartal%202016.
Genau das ist das, was ich zu der Zeit bei einem Maschinenbauer, der sehr stark im ostasiatischen Markt engagiert ist, ebenfalls beobachten konnte. Wachstum entstand nur noch, wenn die Zentralbank den Geldhahn aufdrehte.
Dagegen wuchsen Nordamerika und Westeuropa in der gleichen Zeit relativ konstant. Zwar mit niedrigeren Raten, aber auf einem weit höheren Niveau. Insgesamt durchlebte die chinesische Wirtschaft in den Zehnerjahren eher eine schwächere Phase und das, obwohl ein relativ günstiger Wechselkurs das Außenwirtschaftswachstum stark stützt.
Seit dem Ende des 2. Weltkrieges sind Nordamerika und Westeuropa die wirtschaftlich wohlhabendsten Regionen der Welt. In der Zwischenzeit gab es zahlreiche Versuche von anderen Weltregionen, den Abstand zu verringern. Dabei gab es immer zeitweise Erfolge, ob in Osteuropa der Sechziger und Siebzigerjahre oder in Südamerika in den Achtziger und Neunzigerjahren. Allein, es war nie von Dauer, weil die politischen Rahmenbedingungen nicht stimmten. Warum erreichen die westlichen Regionen also eine Stabilität, die anderen verwehrt bleibt?
An China lässt sich beobachten, dass freies Kapital eine Voraussetzung für Prosperität ist. Aber es ist bei weitem nicht die einzige. Ich bin von dem Erfolg von Südkorea und Taiwan überzeugt. China wird noch mehr zu einem dominierenden Player werden, aber ich bezweifle, dass die Asiaten mit ihrem Modell der Kontrolle dauerhaft die USA ablösen können. Vergessen wir nicht: auch Japan mit weit besseren Bedingungen gelang nicht die Ablösung der USA als führende Wirtschaftsnation. Irgendwann Anfang der Neunzigerjahre kam der Aufholprozess ins Stocken und irgendwann zum Erliegen. Hohe Verschuldung, schnell alternde Bevölkerung, Korsett im Denken ähneln sehr stark den Restriktionen, denen auch China unterliegt. Nur ist Japan keine Diktatur, ein Nachteil, den Peking zusätzlich mit sich schleppt.
Vielleicht noch: die Nazis wie Diktaturen generell, die auf freiheitliche Ordnungen folgen, hatten noch von Erziehung, Bildung, Mentalitätsbildung im 19. Jahrhundert und den Zwanzigerjahren profitiert. Doch weder Russland noch China können auf die Basis einer zivilen Gesellschaft zurückgreifen. Die Menschen kennen nichts anders als Diktatur, sie kennen nichts anderes als dass eine Partei immer bestimmt hat. Nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung besitzt Auslandserfahrung. Wenn wir von Auslandschinesen sprechen, dann meinen wir eine sehr dünne Elite. Das ist in Europa nicht so, nicht nur ein wesentlicher Teil der Studierenden besitzt Erfahrung mit anderen Kulturen und Ideen. Auch der Mittelbau verfügt darüber, sei es durch private Beziehungen und Erlebnisse oder durch Kontakt mit Kollegen. Das funktioniert in Bezug auf China nicht. Wer mit einem Kollegen in Kontakt treten will, muss erst mit dem Vorgesetzten sprechen, da dieser sonst sein Gesicht verliert. Jeder Informationsaustausch ist streng reguliert.
Nein, Ideen entstehen so nicht. Und diese Position werde ich erst überdenken, wenn China als großer Innovator auftaucht. Solange die USA jedoch den Takt vorgeben, überzeugt mich das chinesische Modell nicht.
Ich verlasse mich auch nicht drauf, ich bin skeptisch.
Wie viele Generationen umfasst „auf Dauer“? Dass unfreie Gesellschaften lange Zeit technologisch erfolgreich sein können, zeigen die schon die alten Hochkulturen. Wenn China in 100 Jahren „fails“, was haben unsere Kinder und Enkel davon?
Und: Sind Südkorea und Taiwan wirklich gute Gegenbeipiele? Beide haben in der Nachkriegszeit eine Periode autoritärer Herrschaft durchlaufen. Ich kenne die Geschichte nicht gut genug, aber haben die Tiger wirklich erst danach zum Sprung angesetzt?
Deutschland hat seinen Wohlstand in zwei Weltkriegen pulverisiert. Das ist die Geschichte. Dauer bedeutet mit Substanz auf ein höheres Level heben. Das ist China zweifellos gelungen, aber das gilt für andere Diktaturen auch. Das war nicht der Maßstab der Autoren. Sie haben ihr Buch mit dem Vergleich des mexikanischen Nogales mit dem amerikanischen begonnen und der Frage, warum die Lebensverhältnisse nördlich der Grenze weit besser ausfielen als südlich.
Das ist der Punkt. Hat China aus heutiger Sicht die Chance, bessere Lebensverhältnisse als Nordamerika oder Westeuropa zu bieten? Nein. Der Aufholprozess, den China mit der entfesselnden Kraft des Kapitalismus gestartet hat, hat bisher nur einen Teil des Weges zurückgelegt.
Genauso, wie es eine Neigung von Ökonomen und Statistikern ist, eine Entwicklung gegen Unendlich fortzuschreiben, genauso falsch ist es oft. Menschen und Wirtschaft entwickeln sich nicht linear. Typisch ist, dass viele Wachstumskurven irgendwann zu einem natürlichen Halt kommen, meist, weil die Bedingungen nicht gut oder optimal sind. Ich lebe in meinem Beruf von dieser Erkenntnis.
Meist werden solche Wende- oder Haltepunkte erst in einer längeren Nachschau diagnostiziert. Fakt ist aber, dass China bereits seit einem Jahrzehnt seine Entwicklung auf Basis einer rasant steigenden Staats- wie Privatverschuldung vorantreibt. Hohe Schulden machen Entwicklungen instabil, denn sie bauen darauf und sind davon abhängig, dass das Fundament ebenso schnell mitwächst. Ansonsten entsteht ein Kartenhaus. Die Wachstumskurven, obwohl immer noch hoch, flachen sich naturgemäß ab. Die enorme Ungleichheit verschärft die sozialen Spannungen, Umweltfragen treten auf. Hinzu kommen die stark wachsenden außenwirtschaftlichen Spannungen. Auf die meisten dieser essentiellen Probleme hat die chinesische keine Antworten.
Die USA haben auch eine sehr hohe Verschuldung, aber mehr Substanz in Unternehmen, weit höhere Einkommen, gleichmäßigere Wohlstandsverteilungen. Damit ist die amerikanische Ökonomie weit stabiler. China baut ein System auf absoluter Kontrolle bis hin zum sozialen Auf- und Abstieg durch Sozialpunkte.
Wer sich in einem solchen System Kreativität vorstellen kann, hält wahrscheinlich den Kommunismus immer noch für eine geniale Erfindung.
„Zu einer Zeit, als im Westen viele China nur als verlängerte Werkbank ihrer eigenen Industrien sahen, erkannte der Mitgründer von Microsoft, was in den Computerspezialisten und Programmierern des Landes steckte. Er sah das wissenschaftlich-technische Knowhow und den unternehmerischen Hunger der Chinesen. Beides wollte er nutzen. Daher wurde im Pekinger Lab von Anfang an nicht einfach nur nach Standards programmiert, sondern auch geforscht; hier wurden Netzwerke geknüpft, Verbindungen geschlossen und Communities aufgebaut, Geschäftsmodelle entworfen, Märkte studiert und das Verhalten der Nutzer analysiert. Hier entsprang Chinas heutige IT-Elite.“
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/tiktok-deal-welche-privilegien-microsoft-in-china-geniesst-16917718.html
Das Kaiserreich war aber in vielen Bereichen ein funktionierender Rechtsstaat. Weit mehr als Russland heute.
Danke, gute Idee mit der Übersichtsliste! (Ich gucke aber trotzdem nicht, hier ist Bücherstopp bis mind. Weihnachten!) 🙂
😀 😀 😀
Ich würde es genau umgekehrt sehen. China ist zwar inzwischen hochgradig innovativ, aber eben gleichzeitig äusserst ineffizient, was Verschwendung von Ressourcen, öffentlichen Finanzmitteln, Korruption
und politische Fehlentscheidungen angeht (was nicht heisst, dass man nicht zügig einen modernen Grossflughafen bauen kann, aber nur weil Moskau zügig eine Ubahn hatte, war der Sowietkommunismus auch nicht effizient). Solange man dynamische Wachstumsraten hat, fällt das nur weniger auf.
Inwieweit sehen Sie China als besonders innovativ?
Jepp.