Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]


Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]

Christina Dongowski hat einen Bluesky-Thread voller Meinungen zu Kunst- und Literaturgeschichte geschrieben. Ich fand die spannend und wollte mir ihr darüber reden. Und wir haben da so viel zu reden, dass das hier nur Teil 2 sein kann. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]
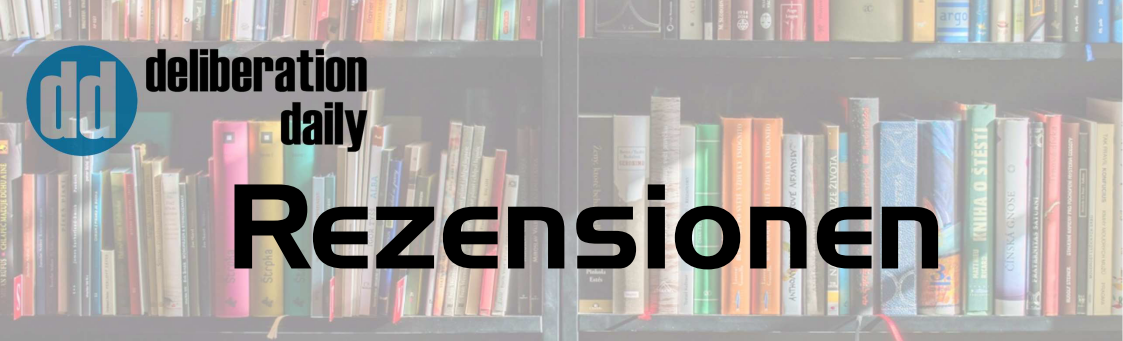
Heinrich August Winkler – Deutungskämpfe. Der Streit um die deutsche Geschichte
 Für die Geschichtswissenschaft mag Leopold von Ranke einmal das Ideal ausgegeben haben, sie solle Dinge darstellen, wie sie gewesen sind. Doch von dieser Idee hat sie sich schon lange emanzipiert, die Vorstellung einer objektiv zutreffenden Geschichtsdarstellung als naiven Mythos entlarvt. Geschichtswissenschaft ist immer auch ein Deutungskampf, Geschichtspolitik sowieso. Es ist deswegen lobenswert, wenn Heinrich August Winkler seinen Sammelband mit Essays aus sechs Jahrzehnten geschichtswissenschaftlicher Tätigkeit mit dem Titel „Deutungskämpfe“ versieht und so mit offenem Visier kämpft: er stellt sich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, streitlustig sicher, aber stets der wissenschaftlichen Methode verpflichtet und mit dem analytischen Blick des Historikers. Bekannt ist Winkler vor allem für sein Mammutwerk zur deutschen Geschichte, dem er den Übertitel des „langen Weg nach Westen“ gegeben hatte; eine klare Missionsansage. Die lange Zeitspanne der veröffentlichten Essays bringt notwendigerweise mit sich, dass ein guter Teil der Meinungskämpfe, in deren Verlauf diese Texte gehören, abgeschlossen ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Manche Debatten sind wahre Evergreens, während andere so sehr zum Konsens geworden sind, dass es aus heutiger Perspektive beinahe ulkig ist, dass sie einmal kontrovers waren. Winklers Sammelband ist somit auch eine historiografische Quelle, wenngleich kein Versuch einer entsprechenden Einordnung unternommen wird: diese müssen die Lesenden selbst leisten, und diese Rezension ist auch ein Experiment darin, das zu wagen. [continue reading…]
Für die Geschichtswissenschaft mag Leopold von Ranke einmal das Ideal ausgegeben haben, sie solle Dinge darstellen, wie sie gewesen sind. Doch von dieser Idee hat sie sich schon lange emanzipiert, die Vorstellung einer objektiv zutreffenden Geschichtsdarstellung als naiven Mythos entlarvt. Geschichtswissenschaft ist immer auch ein Deutungskampf, Geschichtspolitik sowieso. Es ist deswegen lobenswert, wenn Heinrich August Winkler seinen Sammelband mit Essays aus sechs Jahrzehnten geschichtswissenschaftlicher Tätigkeit mit dem Titel „Deutungskämpfe“ versieht und so mit offenem Visier kämpft: er stellt sich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, streitlustig sicher, aber stets der wissenschaftlichen Methode verpflichtet und mit dem analytischen Blick des Historikers. Bekannt ist Winkler vor allem für sein Mammutwerk zur deutschen Geschichte, dem er den Übertitel des „langen Weg nach Westen“ gegeben hatte; eine klare Missionsansage. Die lange Zeitspanne der veröffentlichten Essays bringt notwendigerweise mit sich, dass ein guter Teil der Meinungskämpfe, in deren Verlauf diese Texte gehören, abgeschlossen ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Manche Debatten sind wahre Evergreens, während andere so sehr zum Konsens geworden sind, dass es aus heutiger Perspektive beinahe ulkig ist, dass sie einmal kontrovers waren. Winklers Sammelband ist somit auch eine historiografische Quelle, wenngleich kein Versuch einer entsprechenden Einordnung unternommen wird: diese müssen die Lesenden selbst leisten, und diese Rezension ist auch ein Experiment darin, das zu wagen. [continue reading…]
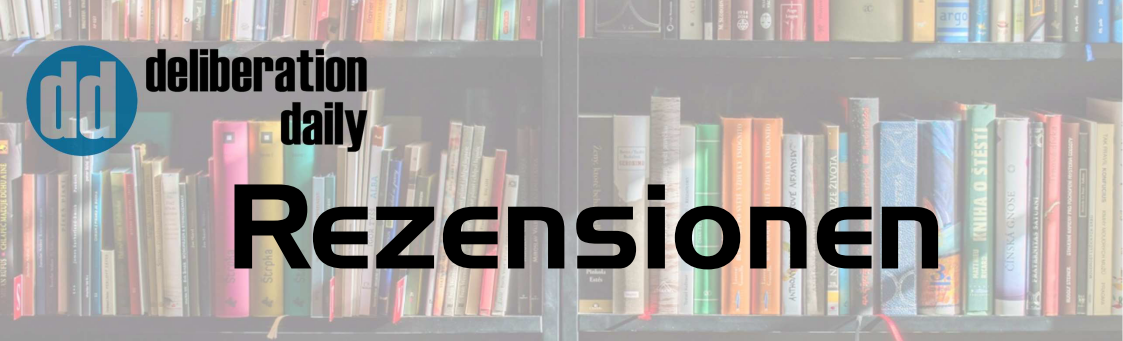
Heinrich August Winkler – Deutungskämpfe. Der Streit um die deutsche Geschichte
 Nazi-Soziologie
Nazi-Soziologie
Zu den entscheidendsten Fragen jüngerer deutscher Geschichtsschreibung gehört die nach dem „Warum“. Warum kam Hitler an die Macht, und wie? Die konservativen Apologeten favorisierten lange eine Erklärung von der Wahl radikaler Spinner, die quasi allein verantwortlich waren, durch verelendete Massen. Doch bereits in den 1960er Jahren begann eine vor allem soziologisch unterfütterte Analyse Raum einzunehmen.
Den Anfang macht eine in Kapitel 10, „Warum die Bauern Hitler wählten„, erst 1963 auf Deutsch erschienen, aber bereits in den 1930er Jahren abgefasste Studie aus Schleswig-Holstein. Darin wurde herausgearbeitet, dass die Bauernschaft Schleswig-Holsteins viel entschiedener und umfänglicher dem Nationalsozialismus verfiel als andere Gruppierungen. Den Grund dafür sieht Winkler vor allem in den vormodernen patriarchalischen Strukturen, die auf dem Land auch zu dieser Zeit noch weitgehend herrschten. Diese Argumentation wird dann in seinen Betrachtungen der Sonderwegsthese später immer wieder aufgegriffen: für ihn ist der entscheidende Unterschied zwischen Deutschland und den westlichen Ländern der starke Agrarsektor mit seiner Adelselite und ihrer Beharrung auf vormodernen Strukturen, weswegen er auch wesentlich bereitwilliger einen Sonderweg zu erkennen bereit ist und von all seinen Kritikern einfordert, diesen Strukturunterschied anders zu erklären (was niemand zu seiner Zufriedenheit tun kann). Ich sehe an dieser Stelle eine leichte Schwäche in Winklers Argumentation, weil er in seiner Betonung des Industrialisierungsgrades Deutschlands – die ja wegen der Vergleichbarkeit zum Westen, von dem sich Deutschland sonderweglerisch entfernt – wirtschaftshistorische Erkenntnisse, etwa in Adam Toozes „Ökonomie der Zerstörung“ (hier besprochen) nicht vorkommen: Deutschland war eben wirtschaftlich nicht auf demselben Entwicklungsstand wie Großbritannien und sowieso nicht wie die USA. Dies modifiziert Winklers Argumentation aber eher, als dass es sie untergräbt.

Die Bundestagswahl ist ein Jahr her, und Merz seit etwa einem Jahr Kanzler (nunja, fast). Grund genug, eine erste Bilanz zu ziehen vom Kabinett Merz I. Wir sprechen über enttäusche oder erfüllte Erwartungen und sprechen auch darüber, welchen realen Hintergrund die aktuellen Arbeitsweltdebatten haben. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]
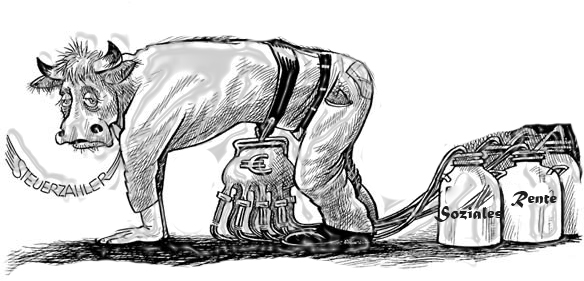 Wenn das Wachstum ausbleibt, sinken die Verteilungsspielräume und der Neid wächst. In dieser Phase der Missgunst befindet sich ein Deutschland, dessen Gesellschaft rapide altert und die Menschen nicht einsehen wollen, dass sie sich ändern müssen, wollen sie wohlhabend bleiben. Die Auswirkungen sind überall zu spüren: Der Finanzminister kommt weder mit Rekordeinnahmen noch mit Billionen Schuldenprogrammen aus, die Beamten kosten die Hälfte der Steuereinnahmen, die Krankenkassen verlangen einstmals als irrsinnig angesehene Beiträge und die Arbeitslosenzahlen bewegen sich trotz Rückgang der Erwerbstätigen Richtung Norden. Ein Staat, der mit dem Geld der Bürger nicht auskommt, hat zwei Optionen. Seltsamerweise scheidet die Kürzung von Leistungen für die Politikerkaste immer aus. So bleibt nur die Suche nach immer neuen Einnahmequellen. Und da gibt es keine Gefangenen. [continue reading…]
Wenn das Wachstum ausbleibt, sinken die Verteilungsspielräume und der Neid wächst. In dieser Phase der Missgunst befindet sich ein Deutschland, dessen Gesellschaft rapide altert und die Menschen nicht einsehen wollen, dass sie sich ändern müssen, wollen sie wohlhabend bleiben. Die Auswirkungen sind überall zu spüren: Der Finanzminister kommt weder mit Rekordeinnahmen noch mit Billionen Schuldenprogrammen aus, die Beamten kosten die Hälfte der Steuereinnahmen, die Krankenkassen verlangen einstmals als irrsinnig angesehene Beiträge und die Arbeitslosenzahlen bewegen sich trotz Rückgang der Erwerbstätigen Richtung Norden. Ein Staat, der mit dem Geld der Bürger nicht auskommt, hat zwei Optionen. Seltsamerweise scheidet die Kürzung von Leistungen für die Politikerkaste immer aus. So bleibt nur die Suche nach immer neuen Einnahmequellen. Und da gibt es keine Gefangenen. [continue reading…]
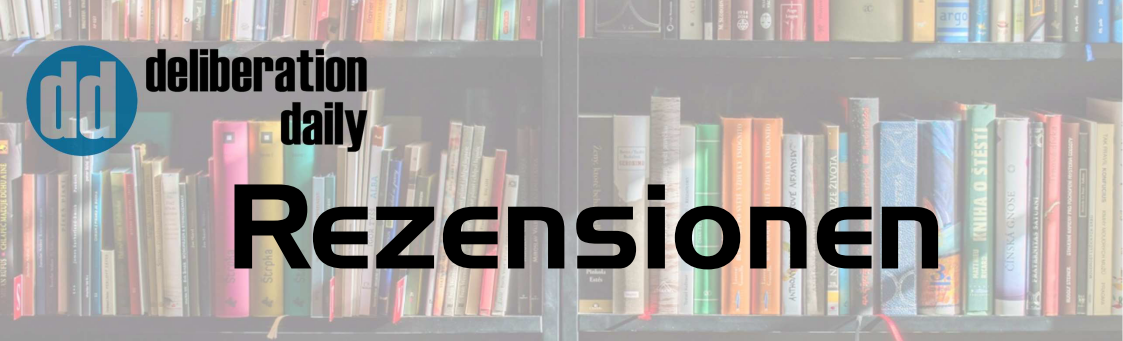
Heinrich August Winkler – Deutungskämpfe. Der Streit um die deutsche Geschichte
 Ostpreußische Adelige und andere Rechte
Ostpreußische Adelige und andere Rechte
Mit dem von mir postulierten Wandel der Geschichtswissenschaft beschäftigt sich Winkler auch auf der Metaebene. In Kapitel 19, „Historiker in ihrer Gegenwart„, ist eine Reflexion Winklers über den Historikerkongress in Berlin von 1964 abgedruckt. Für den jungen Winkler war offenkundig, wie sehr sich die Geschichtswissenschaft einerseits methodisch weiterentwickelt hatte, entschieden weg von der früheren Personen- und Diplomatiegeschichte hin zu Wirtschafts- und Sozialgeschichte, wie sie aber auch ebenso entschieden von den typischen apologetischen Positionen etwa eines Gerhard Ritter abgekommen war. Die Deutungskämpfe der 1950er Jahre waren entschieden. Eine neue Generation von Historiker*innen habe eine klar wahrnehmbare „Linksschwenkung“ der Geschichtswissenschaft weg von konservativer Apologetik bewirkt, die Debatte sei von den Konservativen klar verloren worden. Genauso wie dies später beim Historikerstreit der Fall sein würde war diese Niederlage vor allem dadurch relevant und deswegen für eine neue Generation von Historiker*innen prägend, weil sie wissenschaftlich geschehen sei: ad fontes, auf Basis der Quellen, ließen sich die alten Deutungen nicht mehr halten. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]
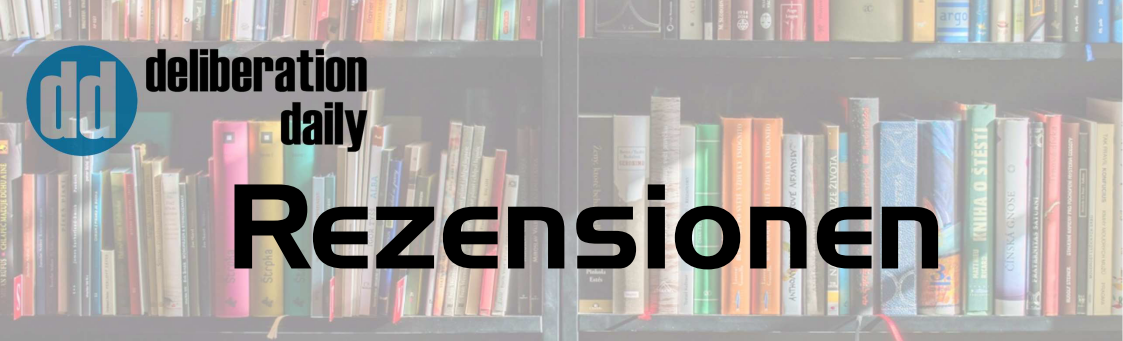
Heinrich August Winkler – Deutungskämpfe. Der Streit um die deutsche Geschichte
 Für die Geschichtswissenschaft mag Leopold von Ranke einmal das Ideal ausgegeben haben, sie solle Dinge darstellen, wie sie gewesen sind. Doch von dieser Idee hat sie sich schon lange emanzipiert, die Vorstellung einer objektiv zutreffenden Geschichtsdarstellung als naiven Mythos entlarvt. Geschichtswissenschaft ist immer auch ein Deutungskampf, Geschichtspolitik sowieso. Es ist deswegen lobenswert, wenn Heinrich August Winkler seinen Sammelband mit Essays aus sechs Jahrzehnten geschichtswissenschaftlicher Tätigkeit mit dem Titel „Deutungskämpfe“ versieht und so mit offenem Visier kämpft: er stellt sich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, streitlustig sicher, aber stets der wissenschaftlichen Methode verpflichtet und mit dem analytischen Blick des Historikers. Bekannt ist Winkler vor allem für sein Mammutwerk zur deutschen Geschichte, dem er den Übertitel des „langen Weg nach Westen“ gegeben hatte; eine klare Missionsansage. Die lange Zeitspanne der veröffentlichten Essays bringt notwendigerweise mit sich, dass ein guter Teil der Meinungskämpfe, in deren Verlauf diese Texte gehören, abgeschlossen ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Manche Debatten sind wahre Evergreens, während andere so sehr zum Konsens geworden sind, dass es aus heutiger Perspektive beinahe ulkig ist, dass sie einmal kontrovers waren. Winklers Sammelband ist somit auch eine historiografische Quelle, wenngleich kein Versuch einer entsprechenden Einordnung unternommen wird: diese müssen die Lesenden selbst leisten, und diese Rezension ist auch ein Experiment darin, das zu wagen. [continue reading…]
Für die Geschichtswissenschaft mag Leopold von Ranke einmal das Ideal ausgegeben haben, sie solle Dinge darstellen, wie sie gewesen sind. Doch von dieser Idee hat sie sich schon lange emanzipiert, die Vorstellung einer objektiv zutreffenden Geschichtsdarstellung als naiven Mythos entlarvt. Geschichtswissenschaft ist immer auch ein Deutungskampf, Geschichtspolitik sowieso. Es ist deswegen lobenswert, wenn Heinrich August Winkler seinen Sammelband mit Essays aus sechs Jahrzehnten geschichtswissenschaftlicher Tätigkeit mit dem Titel „Deutungskämpfe“ versieht und so mit offenem Visier kämpft: er stellt sich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, streitlustig sicher, aber stets der wissenschaftlichen Methode verpflichtet und mit dem analytischen Blick des Historikers. Bekannt ist Winkler vor allem für sein Mammutwerk zur deutschen Geschichte, dem er den Übertitel des „langen Weg nach Westen“ gegeben hatte; eine klare Missionsansage. Die lange Zeitspanne der veröffentlichten Essays bringt notwendigerweise mit sich, dass ein guter Teil der Meinungskämpfe, in deren Verlauf diese Texte gehören, abgeschlossen ist. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Manche Debatten sind wahre Evergreens, während andere so sehr zum Konsens geworden sind, dass es aus heutiger Perspektive beinahe ulkig ist, dass sie einmal kontrovers waren. Winklers Sammelband ist somit auch eine historiografische Quelle, wenngleich kein Versuch einer entsprechenden Einordnung unternommen wird: diese müssen die Lesenden selbst leisten, und diese Rezension ist auch ein Experiment darin, das zu wagen. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]

Die Serie „Vermischtes“ stellt eine Ansammlung von Fundstücken aus dem Netz dar, die ich subjektiv für interessant befunden habe. Die „Fundstücke“ erhalten ausführlichere und thematisch gegliederte Hinführungen zu verschiedenen Artikeln aus den Weiten des Netzes dar. Um meine Kommentare nachvollziehen zu können, ist die vorherige Lektüre des verlinkten Artikels empfohlen; ich übernehme keine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Zusammenfassungen. Für den Bezug in den Kommentaren sind nummerierte Zwischenüberschriften eingezogen, bitte auf die referieren. Dazu gibt es die „Resterampe“, in der ich nur kurz auf etwas verweise, das ich zwar bemerkenswert fand, aber zu dem ich keinen größeren Kommentar abgeben kann oder will. Auch diese ist geordnet (mit Buchstaben), so dass man sie gegebenenfalls in den Kommentaren referieren kann. [continue reading…]


