Hillary Clinton ist in diesem Wahlkampf eine Ausnahmeerscheinung. Sie kann auf eine lange Erfahrung in der Politik zurückblicken, ob in der Zeit des studentischen Aktivismus, an der Seite ihres Mannes im Gouverneurssitz von Arkansas und später im Weißen Haus, danach als Senatorin New Yorks und als Außenministerin in Obamas Kabinett. Das sind rund 30 Jahre im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit. Der eine, dessen Erfahrung vergleichbar wäre, ist John Kasich, aber der Gouverneur von Ohio verbrachte den Großteil seiner Karriere in deutlich niedrigschwelligeren Ämtern. Der andere, dessen Erfahrung vergleichbar wäre, ist Donald Trump, aber seine Prominenz speist sich aus gänzlich anderen Quellen als Hillarys. Alle anderen Kandidaten haben entweder wesentlich weniger Erfahrung, wesentlich weniger Prominenz, oder beides. Dazu ist Clinton eine Frau, die einzige, die bisher aussichtsreich für das Präsidentenamt kandidiert hat. Gleichzeitig ist sie eine hochumstrittene Kandidatin. Wer also ist Hillary Clinton?Ich möchte an dieser Stelle gar nicht endlos in eine Biographie Clintons einsteigen. Stattdessen soll es hier um einige zentrale Erfahrungen gehen, die helfen, die Politikerin besser zu verstehen. Konkret soll dazu die Hochschulpolitik, ihre Zeit im Weißen Haus und ihre Tätigkeit als Senatorin beleuchtet werden.
In ihrer Studentenzeit engagierte sich Clinton in der Hochschulpolitik. Die Atmosphäre war damals aufgeheizt; es war die Zeit der Studentenproteste und die Hochzeit der radikalen Linken. Bernie Sanders war zur gleichen Zeit in der Protestbewegung aktiv, aber der Unterschied zwischen beider politischer Philosophie zeigt sich bereits hier. Clinton zog den Zorn vieler ihrer Kommilitonen auf sich, indem sie nicht die Revolution forderte und auf die beliebten dramatischen Aktionen – Teach-Ins, Sit-Ins, etc. – setzte, sondern stattdessen direkt den „Gang durch die Institutionen“ wählte und die entsprechenden Kanäle nutzte, die vom institutionellen Hochschulwesen zur Verfügung gestellt wurden. Diese Zeit ist für das Verständnis Clintons deswegen wichtig, weil sie bereits in jungen Jahren eine Vorliebe für die Reform über dem Mittel der Revolution zeigte – eine Eigenschaft, die sie mit Barack Obama gemeinsam hat, der den Weg des community organizers wählte, um praktische Umsetzung politischer Ideen zu betreiben.
 Formativ für Clinton war auch ihre Zeit im Weißen Haus, aber aus anderen Gründen. Es war hier, dass sie ihre tiefe Abneigung gegen die Presse entwickelte. Anfangs naiv gab sie offene Interviews, die ihr bald direkt ins Gesicht zurückflogen. Statt ihre Ansichten frei heraus zu äußern, wurde sie immer mehr verschlossen – eine Tendenz, die sich mit der gewaltigen Niederlage beim Versuch einer Krankenversicherungsreform, bei der sie maßgeblich beteiligt war, noch verstärkte. 1992 hatten sie und ihr Mann noch damit Wahlkampf betrieben, dass sie ein Team darstellten, dass, wer Bill wählte, auch Hillary bekam. Sie war die wohl aktivste First Lady seit Eleanor Roosevelt, wenn nicht die aktivste aller Zeiten. Damit befand sie sich auch deutlich mehr im Scheinwerferlicht als üblich. Gleichzeitig rief sie den Zorn all jener auf sich, die dies als eine für Frauen unangemessene Rolle betrachteten, damals noch eine solide Mehrheit der Bevölkerung.
Formativ für Clinton war auch ihre Zeit im Weißen Haus, aber aus anderen Gründen. Es war hier, dass sie ihre tiefe Abneigung gegen die Presse entwickelte. Anfangs naiv gab sie offene Interviews, die ihr bald direkt ins Gesicht zurückflogen. Statt ihre Ansichten frei heraus zu äußern, wurde sie immer mehr verschlossen – eine Tendenz, die sich mit der gewaltigen Niederlage beim Versuch einer Krankenversicherungsreform, bei der sie maßgeblich beteiligt war, noch verstärkte. 1992 hatten sie und ihr Mann noch damit Wahlkampf betrieben, dass sie ein Team darstellten, dass, wer Bill wählte, auch Hillary bekam. Sie war die wohl aktivste First Lady seit Eleanor Roosevelt, wenn nicht die aktivste aller Zeiten. Damit befand sie sich auch deutlich mehr im Scheinwerferlicht als üblich. Gleichzeitig rief sie den Zorn all jener auf sich, die dies als eine für Frauen unangemessene Rolle betrachteten, damals noch eine solide Mehrheit der Bevölkerung.
Es braucht nicht die gewaltige Demütigung des Lewinsky-Skandals um die Mentalität zu verstehen, aus der heraus Madeleine Albright – eine andere Veteranin jener Ära – denjenigen Frauen, die Bernie Sanders unterstützen, einen special place in hell versprach. Für Clinton, Albreight oder auch Slaughter – die 2012 Schlagzeilen mit ihrem Essay „Why Women Still Can’t Have It All“ machte – ist der Platz an der Spitze für Frauen hart erkämpft und ständig prekär. Sie kennen nur eine Welt, in der sie sich als Frauen stets mehr anstrengen müssen als Männer, um dasselbe zu erreichen. Auch Barack Obama gestand ihr diesen Nachteil zu, als er über den Wahlkampf 2008 berichtete, dass er gegenüber Clinton jeden Tag eine Stunde zusätzlich hatte, die sie früher aufstehen musste, um ihre Haare zu richten – ein Problem, das Männer nicht haben, wie Bernie Sanders eindrücklich beweist.
Diese Erfahrungen haben sich in Clintons Psyche eingegraben. Sie ist sehr emfänglich gegenüber Vorwürfen bezüglich ihres Auftretens, weil diese für Frauen viel toxischer sind als für Männer. Das führt direkt zu dem anderen Vorwurf den man ihr macht: mangelnde Authenzität. Letztlich befindet sich Clinton bezüglich ihres Auftretens in der wenig beneidenswerten Position, nichts richtig machen zu können. Ist sie zu kontrolliert, wirft man ihr emotionslose Kälte und Gnadenlosigkeit vor. Zeigt sie Enthusiasmus, wird ihr vorgeworfen, sie schreie zu sehr. Zeigt sie menschliche Wärme, heißt es, diese sei nur gespielt. So verbrachte Clinton große Teile der primary-season 2008 damit, durch jingoistische Äußerungen ihre Härte zu beweisen – ein Problem, das Männer nicht haben. Nun verbringt sie 2016 damit zu zeigen, dass sie menschlich sein kann. Diese widersprüchlichen, zerreißenden Anforderungen hat jüngst der Comedian Jimmy Kimmel aufs Korn genommen:
Die vielen Schein-Skandale der 1990er Jahre, die von den Republicans während der Gingrich-Revolution (siehe hier) normale Strategie wurden, hinterließen ebenfalls ihre Spuren. Es zeigte sich zwar, dass an praktisch nichts davon etwas dran war, aber gemäß der Weisheit „Wo Rauch ist, ist auch Feuer“ blieb an Clinton eine negative Reputation haften, die stets etwas Sinistres transportierte. Bill Clinton, der diese ständige Bombardierung ebenfalls erdulden musste, blieb davon deutlich stärker verschont als seine Frau. In einem Artikel auf Slate führt Christina Gauterucci dies auf das so genannte Imposter-Syndrome zurück: Frauen, besonders Frauen in Machtpositionen, wird grundsätzlich stärker misstraut als Männern. Es muss für Clinton unendlich schmerzlich sein, dass ihr Mann, der erwiesenermaßen unter Eid log und sie betrog, deutlich höhere Beliebstheits- und Vertrauenswerte genießt als sie, der nie ein schlimmer Skandal nachgewiesen werden konnte.
Die letzte Episode, die das Phänomen Clinton zu verstehen hilft ist ihre Zeit im Senat. Hier engagierte sie sich von Beginn an außenpolitisch, unter anderem durch ihre Tätigkeit im Comitte of the Armed Forces, war aber auch im Haushaltsausschuss, dem Umweltausschuss und dem Arbeitsmarktausschuss tätig. Sie war eine aktive Senatorin und an über 700 Gesetzesvorhaben beteiligt. Wie in jedem ihrer Ämter zeichnete sie sich durch Detailkenntnis und Arbeitseifer aus – kein Vergleich etwa zu ihren Konkurrenten Cruz und Rubio in diesem Wahlkampf, die beide wenig Substanz in ihrer Senatszeit vorzuweisen haben. Ihre wohl kontroverseste Entscheidung während der Senatszeit aber, die sie 2008 den Sieg in den primaries kosten sollte, war die Stimme für den Irakkrieg. Damit war sie wahrlich nicht allein; auch John Kerry, der Kandidat von 2004, war „for the war until I was against it„, und wie so viele Democrats änderte Clinton ihre Meinung bis 2006/2007. In einem ihr bereits schmerzlich bekannten Muster litt sie an den Folgen deutlich länger als viele andere, männliche Democrats. So verlor sie nicht nur die Vorwahlen 2008, sondern muss sich nun auch anhören, dass der Wandel in ihrer Meinung nicht „echt“ sei, sondern lediglich ein Nachvollziehen der öffentlichen Meinung.
Gleichzeitig zeichnete sich ihre Senatskarriere durch das Wahrnehmen vieler lukrativer Einnahmemöglichkeiten aus, vor allem durch das Halten von Reden bei Wallstreet-Firmen wie Goldman Sachs. Teilweise waren diese Reden für sie und Bill Clinton notwendig, weil sie viel persönliches Geld in die Wahlkämpfe für Clintons Senatssitz und später für die Präsidentschaftskandidatur 2008 gesteckt hatten. Andererseits aber warfen sie ein schlechtes Licht auf sie, nicht nur, weil sie und ihr Mann nicht gerade im Verdacht stehen, die Wallstreet besonders hart anzufassen. Nicht umsonst bezogen beide viele Wahlkampfspenden aus dem Finanzmarktsektor.
So begegnet Clinton im Vorwahlkampf 2016 vielen Dämonen ihrer Vergangenheit wieder. Man wirft ihr vor, ein hawk zu sein, kaum besser als viele Republicans; von der Wallstreet gekauft zu sein; eine unechte, gekünstelte Persönlichkeit; keine echte Progressive; unehrlich und nicht vertrauenswürdig.
Der Vorwurf, sie sei eine Kunstperson und nicht „authentisch“ ist ein typisches Produkt des Hauptstadtjournalismus mit seiner Fokussierung auf Zitate und persönliche Narrative. Angela Merkel hatte jahrelang mit demselben Problem zu kämpfen. Wie Marc Armbinder auf FiveThirtyEight zurecht bemerkt hat, ist der oft in den Raum geworfene Begriff der „Authenzität“ ohnehin hohl und wenig aussagekräftig. Hillary Clinton ist, wie auch Angela Merkel, authentisch darin, große Events und soziale Anlässe nicht sonderlich zu mögen und in solchen Umgebungen steif und förmlich zu sein. Sie ist authentisch darin, Kompromisse zu suchen, auf die öffentliche Meinung achtzugeben und sich in Details zu verlieren. Das ist weniger spannend als die permanenten gaffes eines Joe Biden oder Donald Trump, es hat wenig vom raubeinigen Revoluzzer-Charme Bernie Sanders‘ und es fehlt die kosmpolitische Anziehungskraft Barrack Obamas. Es ist aber schlicht ihre Persönlichkeit. Echt, aber im Wahlkampf wenig hilfreich.
Es kann kaum bestritten werden, dass Clinton eine deutliche Nähe zu den Neokonservativen hat, was die Außenpolitik anbetrifft. Sie ist deutlich aggressiver als Obama und plädiert instinktiv für Interventionen. Es waren Clinton und ihr Team, die Obama zu der Intervention in Libyen 2011 überredeten, und sie scheiterten mit einem ähnlichen Versuch, ihn 2013 zu einer Intervention in Syrien zu bewegen. Erst kürzlich gab Slaughter, ehemaliges Stabsmitglied Clintons, dem Spiegel in einem Interview zu Protokoll, dass sie immer noch dafür sei, dass man hätte Flugverbotszonen einrichten und Assads Militär bombardieren sollen. Auch spricht sie sich wie Clinton gegen Obamas diplomatischen Ansatz zu Verhandlungen mit Assad und Putin in Genf aus. In dem Interview sagte Slaughter selbst, dass dies „Instinkte des Kalten Kriegs“ seien, und hier ist auch die mit Abstand berechtigste Kritik Clintons zu finden. Ihre außenpolitischen Ansichten sind eher auf einer Linie mit Bush, Reagan und ihrem Ehemann als mit Obama, und ihr Sieg würde mit Sicherheit eine aggressivere US-Außenpolitik mit sich ziehen. Das allerdings gilt für jeden republikanischen Kandidaten umso mehr. Selbst Sanders‘ isolationistische Instinkte dürften sich gegen das außenpolitische Establishment in Washington schwertun, dem sich Clinton mit Haut und Haar verschrieben hat.
Schwieriger zu beurteilen ist das Thema Wallstreet. Einer von Sanders‘ mächtigsten Angriffspunkten gegen Clinton ist, dass sie nicht sonderlich glaubwürdig in ihren Versprechungen zu einer stärkeren Regulierung der Wallstreet sei, weil sie so viele Spenden angenommen und (geheime) Reden gehalten hat. Auf der einen Seite begibt sie sich damit sicherlich in eine Form der Abhängigkeit, besonders wenn man ihr unterstellt, nach ihrer Kandidatur und gegebenenfalls Amtszeit erneut Reden halten zu wollen. Jedoch steht auf der anderen Seite das nicht nur von Bernie Frank (der aus Dodd-Frank) vorgebrachte Argument, dass man nicht „unilateral abrüsten“ könnte, solange Wallstreet-Millionen in die Kassen der Republicans fließen. Zugleich gibt es keine Gesetzesvorhaben, die Clinton entweder unterstützt oder blockiert hätte, die sonderlich positiv oder nachteilig für Wallstreet gewesen wären. Dieser Aspekt ihrer politischen Persona spielt daher nahtlos in den generellen Verdacht über, nicht vertrauenswürdig und unehrlich zu sein.
Dieser Vorwurf ist auch der mit Abstand toxischste in dieser Wahl. Rund 40% der Anhänger der Democrats halten sie für wenig vertrauenswürdig oder ehrlich, eine in einem solch polarisierten Klima verheerende Zahl. Für die Republicans rangiert sie ohnehin nur knapp hinter dem Teufel und Karl Marx. Proponenten dieser Vorwürfe wie der Journalist Ron Fournier berufen sich auf zahlreiche Instanzen, in denen Clinton ihre Meinung änderte oder Skandale wie Benghazi und die Geschichte um ihren privaten Email-Server. Auf der Gegenseite stehen Journalisten wie die Guardian-Autorin Jill Abramson, die die Clintons seit Jahrzehnten äußerst kritisch begleitet und in den 1990er Jahren viele der Skandale und Skandälchen recherchierte, von denen oben die Rede war. Abramson veröffentlichte jüngst einen Artikel, in dem sie verkündete, dass Clintons untrustworthiness nur ein PR-Gag sei und ihr noch niemand etwas nachweisen konnte: „As an editor I’ve launched investigations into her business dealings, her fundraising, her foundation and her marriage. As a reporter my stories stretch back to Whitewater. I’m not a favorite in Hillaryland. That makes what I want to say next surprising. Hillary Clinton is fundamentally honest and trustworthy.“ Auf der anderen Seite ist und bleibt politische Korruption nur schwer nachzuweisen, so dass dieser Vorwurf wohl ewig ohne entgültige Klärung bleiben wird.
Was also ist, zuletzt, mit dem Vorwurf Sanders‘ (und 2007/08 Obamas), dass Clinton keine echte Progressive sei und die Linken ans Establishment verkaufen würde? Hier ist der Rückgriff auf die eingangs erzählte Geschichte ihrer Studentenzeit hilfreich. Begreift man sich als einen Revolutionär, der das aktuelle System Washingtons als verrottet und jenseits aller Rettungsmöglichkeiten sieht, das nur durch radikale Eingriffe verbessert werden kann, dann ist Clinton keine Progressive. Sie ist eine klassische Politikerin der Mitte, die sich Mehrheiten sucht und Kompromisse schließt. Wo eine Position keine Mehrheit hat, wird man Clinton nicht finden. Erweitert man das Spektrum dessen, was als „progressiv“ gelten darf, so kann Clinton sich diesen Mantel umhängen. Genauso wie Barack Obama sieht auch sie in den kleinschrittigen Reformen und Reförmchen den einzigen Weg, einen dauerhaften Wandel in der Gesellschaft zu erreichen, und hat dies für fast ein halbes Jahrhundert so gesehen.
Clinton ist eine gesetzte Größe. Nach einem Menschenleben in der Politik ist das auch kaum anders zu erwarten. Sie dürfte die am besten durchleuchteste Persönlichkeit der politischen Szene sein und wird kaum Überraschungen bieten. Wie also steht es um ihre Chancen in der general election? Kann sie gewinnen? Oder verliert sie vielleicht sogar vorher noch die Kandidatur an Bernie Sanders?
Zuerst die schlechte Nachricht für all jene, die immer noch auf dem #FeelTheBern-Zug mitfahren: Clintons Nominierung ist, sofern nicht eine wirklich gewaltige Katastrophe dazwischenkommt, ausgemachte Sache. Sie führt Bernie Sanders deutlich, und die verbliebenen primary-Staaten wie New York und Kalifornien sind nicht dazu angetan, diese Kluft zu verkleinern.
In der Wahl selbst hat sie gute Aussichten. Dies liegt weniger an ihrer Stärke als Kandidat – tatsächlich sprechen einige der oben genannten Faktoren gegen sie – als an einigen anderen Faktoren, die sich wesentlich stärker auswirken. So ist die Wirtschaft weiterhin in einem sanften Aufwind, was die Wahl der Partei des Amtsinhabers ebenso begünstigt wie Wahl eines Democrat generell. Zudem hat Clinton ihr politisches Schicksal direkt an Barack Obama gekettet und tritt effektiv als seine dritte Amtszeit an – angesichts seiner stetig steigender Beliebtheitswerte und ihrer Stärke in den primaries bei den Wählern der Obama-Koalition (Akademiker, Schwarze, Latinos, Frauen) eine Entscheidung, die sich auszahlt. Zudem profitiert Clinton von der großen Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft, die selbst lauwarme Anhänger nicht ernsthaft über ein Wechselwählerverhalten nachdenken lässt.
Clinton ist aber selbst kein schlechter Kandidat. Sie ist nicht so stark wie es etwa Obama war, aber bei weitem nicht so mies, wie es oft in den Medien kolportiert wird. Ihre Basis ist breiter als die von Sanders, und in einer aktuellen Gallup-Umfrage zeigten sich mehr Clinton-Unterstützer „extrem“ oder „sehr“ enthusiastisch über sie als Kandidatin denn als über Sanders (54% gegenüber 44%), der sich so gerne als großer Basisrebell feiern lässt. Ihre Wahlkampforganisation ist hervorragend, ihre Kriegskasse gefüllt, ihr Stab koordiniert und ihre opposition research sauber durchgeführt. Sie kann begeistern, sie kann gute Reden halten (wenn auch nicht großartige), und sie strahlt in allem, was sie tut, ungeheure Kompetenz aus. All dies dürfte in einem Duell gegen Trump oder Cruz deutlich für sie sprechen. Die Chancen stehen daher gut, dass wir im Januar 2017 der Vereidigung der ersten Präsidentin der Vereinigten Staaten beiwohnen dürfen.

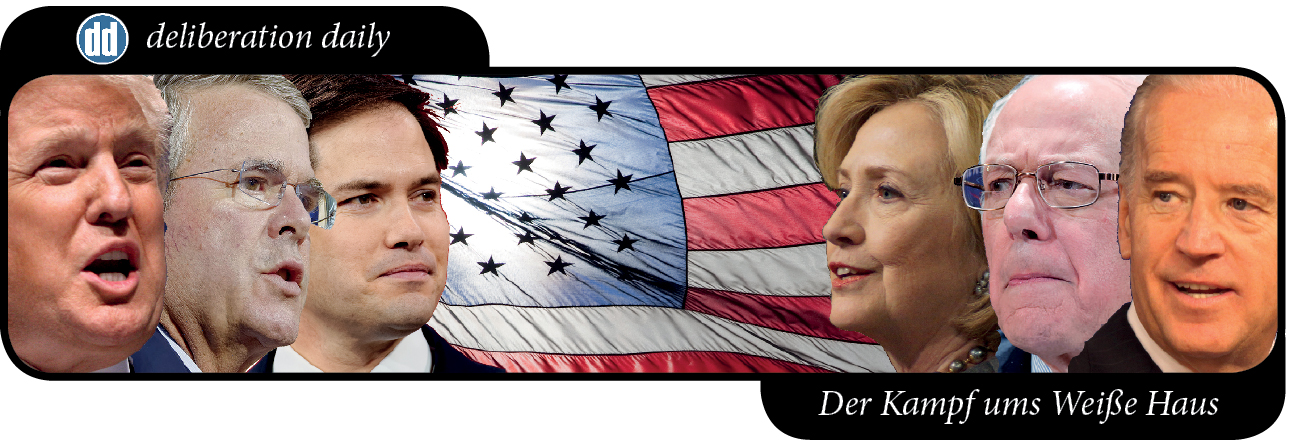

„Sie kennen nur eine Welt, in der sie sich als Frauen stets mehr anstrengen müssen als Männer, um dasselbe zu erreichen“
Hillary hat ihre aktuelle Position nicht dadurch erlangt, dass sie sich mehr anstrengte als Männer, sondern dadurch, dass sie den richtigen Mann geheiratet hat. Wie sagt doch das alte Sprichwort: „Wer den Papst zum Onkel hat, braucht um den Kardinalshut nicht sorgen.“
Vielleicht, aber damit wäre sie ja nicht alleine. Das Argument zählt für Vergleiche mit Ted Kenney oder George W. Bush genauso. Oder Jeb Bush. etc.
Von den genannten kandidiert aber keiner (mehr). Da ist Hillary die einzige.
Die Aussage bleibt aber wahr, weil sie alle ziemlich eindeutig in Hillarys Erlebnishorizont fallen.
Was hat es eigentlich mit Hillary Clintons Reden vor Bankern auf sich? Sind das Alibi-Veranstaltungen um Geld einzuwerben bzw. um Abhängigkeiten zu schaffen? Dass die Banker an den Inhalten der Reden interessiert wären, kann ich mir nicht vorstellen.
Gibt es Parallelen zu Steinbrück oder läuft das in den USA ganz anders?
Wie bei Steinbrück auch. Davon abgesehen sind die Banker vermutlich schon an ihr interessiert. Ich meine, glaubst du die geht direkt nach der Rede wieder? Danach hast du Zeit im vertraulichen Rahmen zu reden. Und bevor jetzt wieder alles „Korruption!“ schreit, das geht in beide Richtungen und ist gängige wie gute Praxis. Das Problem ist nur wenn tatsächlich Käuflichkeit entsteht.
Davon abgesehen ist das auch schon wieder eine typische Situation für die One-Percenters: Clinton als Rednerin ist extrem teuer. Das macht sie attraktiv. Wie viele Leute können schon teure Weine von billigen unterscheiden? Das schaffen nicht mal die Weinexperten. Alles, was zählt, ist das Preisschild. Das sollte man weder bei Clinton noch bei Steinbrück außer Acht lassen. Letztlich gewinnen da beide Seiten.
Aber schau dir mal das reine Volumen dieser Reden im Vergleich zu den Gesamtspenden an, die Clinton bisher erhalten hat. Das ist praktisch nichts. Selbst wenn du die Wallstreetspenden dazuaddierst kommst du noch auf keine signifikanten Anteile. Dafür spenden einfach zu viele. Die Wallstreet kauft sich nicht Clinton, sie kauft sich einen Platz am Tisch. Würden Sie nicht spenden, hätte Clinton es leichter sie auszusperren, weil es keine Berührungspunkte gibt.
Das sieht man übrigens schön auch bei Sanders. Als 2009 in der Obama-Regierung fieberhaft an neuen Finanzregulierungen gearbeitet wurde (woraus dann ja auch Dodd-Frank enstand) befasste sich Sanders hauptsächlich mit der ollen Kamelle von Glass-Steagal. Entsprechend hatte er mit den Gesetzen später nichts zu tun und keine konstruktive Rolle. Wie auch? Ihm fehlten alle Insiderinfos. Wenn Clinton irgendwelche Details wissen will, kann sie den CEO von Goldman Sachs direkt fragen. Klar wird der ihr seine gefärbte Version geben – aber gerade hier zeigt sich Clintons größte Stärke, ihr Auge für Details und ihre unabhängigen Berater im eigenen Haus.
Danke für den Hinweis, Stefan. Dodd-Frank ist hierzulande wenig bekannt. Die Details musste ich erst mal nachlesen. Geht das nur mir so?
Demnach kann die US-Finanzindustrie nicht „weitermachen wie vor der Finanzkrise“ wie ich wiederholt gehört und gelesen habe?
P.S. Interessante Preistheorie bei Wein und Rednerhonoraren 😉
Nicht exakt so, nein. Dodd-Frank ist natürlich keine Wunderwaffe, die alle Probleme gelöst hat; insbesondere „too big to fail“ bleibt weiterhin bestehen. Aber eine Menge Kleinkram wurde angegangen. Wir haben Dodd-Frank kurz hier gestreift: http://www.deliberationdaily.de/2014/09/warum-obama-alles-andere-als-eine-enttaeuschung-ist/
Sorry, ich komme etwas spaet zu der Diskussion. Aber wieso ist Glass-Steagal eine olle Kamelle?
Das habe ich mich auch gefragt, aber mangels ausreichenden Hintergrundwissens hier nicht zu fragen getraut.
Weil die Finanzkrise nicht hauptsächlich wegen dem repeal von Glass-Steagal zustande kam, was auch der nicht gerade als Reaktionär verdächtige Paul Krugman immer wieder betont. Es ist zu so einer Art Monstranz geworden, aber praktisch alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, weisen ihm nur eine Randbedeutung zu. Eine Wiedereinsetzung von Glass-Steagal würde die grundlegenden Probleme nicht wirklich angehen.
Und an der Stelle hoffe ich, dass niemand weiter nachfragt, weil viel detaillierter kann ich mangels Fachwissen leider nicht wirklich werden, da müsste man Ökonomieexperten haben. Ich lese diese Argumentation nur sehr oft gerade in den liberalen Publikationen (siehe Leseliste).
Und bitte immer fragen, vielleicht käue ich ja nur irgendwelchen Mist wieder und ihr ertappt mich dabei. Soll ja vorgekommen sein 😉
Und an der Stelle hoffe ich, dass niemand weiter nachfragt
Die Hoffnung muss ich leider enttaeuschen … 😉
Es ist zu so einer Art Monstranz geworden, aber praktisch alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, weisen ihm nur eine Randbedeutung zu. Eine Wiedereinsetzung von Glass-Steagal würde die grundlegenden Probleme nicht wirklich angehen.
Also das stimmt so nicht. Von der Wikipedia-Seite zur „Glass-Steagall Legislation“ nehme ich etwa das Zitat:
Many commentators have stated that the GLBA’s repeal of the affiliation restrictions of the Glass–Steagall Act was an important cause of the financial crisis of 2007–08.[9][10][11] (mit entsprechenden Referenzen)
Interessant in dem Zusammenhang ist auch ein Interview von 2015 mit dem Wirtschaftsnobelpreistraeger Joseph Stiglitz zum Thema:
http://www.democracynow.org/2015/10/27/nobel_laureate_joseph_stiglitz_on_rewriting
Zitat aus dem Interview:
So, Glass-Steagall was—again, after the Great Depression, we divided the banks into two groups: the commercial banks, that take your deposits, ordinary people, supposed to give money to small businesses to help grow the economy; and then you had the investment banks, taking money from rich people, investing it in more speculative activities. And we had a big fight during the Clinton administration over whether we should eliminate that division. I strongly opposed it. And when was chairman of the Council of Economic Advisers, it didn’t happen.
[…]
And the result of that was that we repealed Glass-Steagall. And what I was worried about precisely happened. We wound up with bigger banks that became too big to fail. The culture of risk taking, that’s associated with the investment bank, spread to the whole banking system, and so all the banks became speculators, actually lending to small businesses lower than it was before the crisis. And the kinds of conflicts of interest that were rampant in the years before the Great Depression started to appear all over the place in our financial sector.
So wie ich es verstehe, hat Glass-Steagall das hochriskante Investmentbanking eben vom normalen Einlagengeschaeft getrennt. Der Vorteil von Glass-Steagall waere, dass der Staat in einer Krise die reichen Spekulanten im Investmentgeschaeft einfach pleite gehen lassen kann, aber gleichzeitig die Kundeneinlagen im normalen Bankgeschaeft schuetzen kann. Weil beide separate Systeme sind. Erlaubt man den Banken aber mit den Einlagen ihrer Kunden auf hochriskante Wetten zu zocken, dann ist in der Krise auch das Geld der kleinen Leute weg. Der Staat muss dann nicht nur die normalen Leute, sondern auch die Zocker retten, was die ganze Sache auf Kosten der Gesellschaft – und zum Nutzen der Reichen – viel, viel teurer macht. Natuerlich kann man argumentieren, dass Glass-Steagall die Finanzkatastrophe 2008 nicht voellig verhindert haette. Aber der Bailout und auch der Fallout fuer den Rest der Gesellschaft waere wohl erheblich kleiner gewesen.
Glass-Steagal ist, in einem Satz, die Trennung von Privatbanken- und Investmentgeschäft. Aber bei allem Respekt für Stiglitz, das ist schlicht nicht sein Spezialgebiet. In einem aktuellen Krugman-Artikel geht der noch mal darauf ein:
„Let me illustrate the point about issues by talking about bank reform.
The easy slogan here is “Break up the big banks.” It’s obvious why this slogan is appealing from a political point of view: Wall Street supplies an excellent cast of villains. But were big banks really at the heart of the financial crisis, and would breaking them up protect us from future crises?
Many analysts concluded years ago that the answers to both questions were no. Predatory lending was largely carried out by smaller, non-Wall Street institutions like Countrywide Financial; the crisis itself was centered not on big banks but on “shadow banks” like Lehman Brothers that weren’t necessarily that big. And the financial reform that President Obama signed in 2010 made a real effort to address these problems. It could and should be made stronger, but pounding the table about big banks misses the point.“
Aber bei allem Respekt für Stiglitz, das ist schlicht nicht sein Spezialgebiet.
Naja, da machst Du es Dir aber ein bisschen einfach. Joseph Stiglitz ist ein renomierter Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftsnobelpreistraeger. Dass der zu einem so wichtigen und oft diskutierten Thema eine solide und fundierte Meinung hat und nicht einfach dummes Zeug daherplappert, darf man ihm doch zugestehen. Auch wenn es nicht sein Fachgebiet ist. Stiglitz ist darueber hinaus ja auch schliesslich nicht der einzige, der einen Zusammenhang zwischen dem Repeal von Glass-Steagall und dem Bankencrash von 2008 sieht.
But were big banks really at the heart of the financial crisis, and would breaking them up protect us from future crises?
Also Krugmans Kommentar hat nur bedingt mit dem Thema zu tun (siehe unten). Ob die Banken zu gross sind und deshalb in kleinere Einheiten gespalten werden sollten, ist ein anderes Problem, als die Frage, ob der Investmentsektor vom Einlagengeschaeft getrennt werden sollte.
Waere die letztere Trennung beim Crash 2008 noch gegeben gewesen, haette man die Investmentbanken und all ihre Spekulanten einfach alle pleite gehen lassen koennen. Das ist doch das, was im Kapitalismus eigentlich passieren sollte, wenn sich jemand brutal verzockt, oder? Aber da die Banken auch mit ihren Kundeneinlagen, also mit dem Geld von Dir und mir, gespielt haben, musste der Staat zur Rettung schreiten – oder eben die voellig unschuldigen Sparer alle mit in den Abgrund stuerzen lassen. Da liegt doch das Problem. Glass-Steagall verhindert vielleicht keine Krisen, aber es macht die Abwicklung von Krisen einfacher und unproblematischer, weil es den Crash eingrenzt. Zumindest ist das doch die Idee dahinter, oder?
Zweitens argumentiert Stiglitz, dass die Aufhebung von Glass-Steagall dazu gefuehrt hat, dass Banken insgesamt groesser geworden sind. Das hat gleich mehrere schlechte Auswirkungen.
Erstens waechst die politische Macht der Banken mit ihrer Groesse. Wir haben dadurch also Giganten mit enormem politischen Einfluss geschaffen, der in unserer Gesellschaft nirgendwo demokratisch legitimiert ist und der auch nicht unter demokratischer Kontrolle steht.
Zweitens haben wir durch die Vergroesserung der Banken Institutionen geschaffen, die „too big to fail“ sind. Wir zwingen uns also als Gesellschaft diese Institutionen unter massivem Einsatz der Steuerzahler und unter Inkaufnahme von dramatischer Verschuldung, die unsere Kinder mal abbezahlen werden muessen, um jeden Preis zu retten. Gerettet werden dadurch natuerlich die reichen Zocker. Und die alleinerziehende Mutter, der Brieftraeger, die Kassiererin, der Lehrer, der Busfahrer und die Krankenschwester zahlen die Zeche. Das kann nun wirklich beim besten Willen nicht gerecht sein.
Drittens sind die aufgeblasenen Institutionen, die der Repeal von Glass-Steagall mit geschaffen hat nicht nur „too big to fail“, sondern deren CEOs sind auch noch „too big to jail“. Das heisst, wir bekommen ploetzlich ein Zweiklassenrecht, wo einige so maechtig sind, dass sie ueber dem Gesetz stehen. Im franzoesischen Absolutismus des 17. Jahrhunderts oder im roemischen Kaiserreich waere das wohl keine grosse Besonderheit. Aber in unserer Zeit ist so etwas eigentlich voellig unfassbar. Und der Anfang vom Ende der Idee des Rechtsstaats.
Zusammengefasst hat die Ruecknahme von Glass-Steagall vielleicht nicht direkt den Bankencrash von 2008 ausgeloest, aber sie hat ein Umfeld geschaffen, in dem den Staaten de facto nur noch uebrig blieb, mit dem Geld der normalen Buerger fuer die reichen Zocker zu buergen. Eine Abwicklung auf Kosten derer, die die Katastrophe verursacht haben, wurde unmoeglich. Eine juristische Aufarbeitung wurde ebenfalls unmoeglich.
Und all das haben die Banken natuerlich auch gewusst. Denn die sind ja nicht bloed. Wenn ich aber weiss, dass der Staat mich zur Not immer retten wird, egal wie dreist ich mich verzocke und wenn ich weiss, dass ich keinerlei juristisches Nachspiel zu befuerchten habe, dann hat das mit Sicherheit auch einen deutlichen Einfluss auf das Risiko, das ich in meinen Wetten am Markt eingehe. Und mit Hinblick darauf hat die Ruecknahme von Glass-Steagall dann doch moeglicherweise auch direkt einen Beitrag zur Krise geleistet.
Klingt durchdacht und schlüssig.
Clintons PR scheint zu wirken, auch bei Stefan Sasse. Die Wall Street ist ja nicht „bloed“.
Als eine Regel ist mir völlig egal, was die Politiker selbst sagen. Ich bilde mir meine Meinung hauptsächlich aus dem Aggregrat verschiedener Analysen (siehe Leseliste). Clintons PR interessiert mich genausowenig wie Bernies.
Das Problem ist meinem Verständnis nach nicht die pure Größe der Banken. Die Finanzkrise wurde ja erst so schlimm, WEIL die Bush-Regierung ein Institut – Lehmann Brothers – pleite gehen ließ. Die Finanzkrise entstand ja weniger durch die Investmentbanken selbst als durch einige Subbereiche, die von Glass-Steagal gar nicht beührt werden, etwa den Versicherungssektor (AIG). Das ist zumindest mein zugeben beschränktes Verständnis der Materie.
Der Zusammenbruch von AIG war nur bedingt Ursache und stattdessen eher eine Konsequenz der Krise. Wenn ein Versicherer baden geht, weil er sich uebernommen hat, dann ist das eine Reaktion auf einen Schaden, der BEREITS ENTSTANDEN ist.
Die Ursache fuer die Bankenkrise 2008 war nach meinem Verstaendnis uebrigens multikausal. Es gibt kein SIMPLES REZEPT, um solche Katastrophen fuer die Zukunft auszuschliessen. Niemand behauptet, dass das Wiederbeleben von Glass-Steagall einen Finanzkollaps fuer alle Zeiten unmoeglich machen wuerde. Aber Glass-Steagall waere ein wichtiger und aus meiner Sicht essentieller Punkt in einem Programm, das unser Finanzsystem sicherer machen soll.
Weshalb kam es zur Finanzkrise (nach meinem Verstaendnis; ich bin kein Wirtschaftsexperte)? Da waren a) die Banken, die voellig unverantwortliche Kredite ausgaben. Natuerlich taten die das nur, weil sie wussten, dass sie nicht auf den zu erwartenden Kreditausfaellen sitzen bleiben wuerden. Denn b) Investmentbanken buendelten und verschachtelten diese Kredite in dubiosen, kaum mehr zu durchschauenden Finanzprodukten und zockten damit auf den Finanzmaerkten. Das natuerlich war nur moeglich, weil c) die Ratingagenturen diesen Finanzprodukten voellig unbegruendete AAA-Ratings gaben und Kaeufer somit ueber das Risiko taeuschten. Die Punkte b) und c) waren nur moeglich, weil d) sowohl Ratingagenturen als auch Investmentbanken wussten, dass sie rechtlich Narrenfreiheit besassen (too big to jail) und notfalls ohnehin vom Staat gerettet werden wuerden (too big to fail). Bis auf den Sonderfall Lehman Brothers ist diese Rechnung ja auch voellig aufgegangen. Nicht nur in den USA, sondern praktisch global.
Glass-Steagall, so argumentierst Joseph Stiglitz, hat die Vergroesserung von Banken bewirkt und „too big to fail“ sowie „too big to jail“ ueberhaupt erst moeglich gemacht. Glass-Steagall hat darueber hinaus auch zweifellos bewirkt, dass die Vernetzung von Bankengeschaeften zugenommen hat, weil die Kundeneinlagen aus dem regulaeren Bankengeschaeft ploetzlich nicht mehr von dem Investmentgeschaeft isoliert waren. Banken leihen sich gegenseitig Geld, verschulden sich also wechselseitig. Geht eine Bank Pleite, faellt deshalb morgen die naechste. Und dann die naechste. Wie in einem Dominospiel. Die erste Bank, die faellt, mag eine reine Investmentbank sein, wie Lehman Brothers, die ja gar kein Einlagengeschaeft hatten. Aber der naechste Dominostein ist dann womoeglich eine Bank, die sowohl Investment- als auch regulaeres Banking betreibt. Und wenn die faellt, dann ist das Ersparte der Kleinkunden weg. An dem Punkt muss der Staat dann einschreiten und die Bank retten. Und die reichen Zocker lassen ihre Verluste dabei vom Steuerzahler uebernehmen. Mit Glass-Steagall waere das nicht noetig. Man koennte die Zocker einfach absaufen lassen.
Das ist doch so, als ob in einer Stadt ein Kasino pleite geht. Kuemmert das irgendwen, ausser den unmittelbaren Angestellten des Kasinos? Die Antwort ist nein. Der Schaden ist aeusserst eingegrenzt. Aber was wenn alle Kasinos der Staat Vertraege haben wechselseitig fuer einander zu haften und ein Schadensfall eintritt, der zu gross ist, als dass er gestaemmt werden koennte? Dann wird es zu einer Kettenreaktion kommen. Das erste Kasino wird fallen. Wenn dann die anderen Kasinos finanziell einspringen muessen, werden die auch pleite gehen. Das wird noch weitere Kasinos in den Abgrund reissen. Am Ende wird die gesamte Branche kollabieren. Ist das ein Problem fuer die Stadt? Die Antwort ist wohl bedingt ja. Aber es ist immer noch keine Katastrophe. Die Krise ist ja immer noch einigermassen isoliert. Nur Kasinos sind betroffen. Fuer die uebergrosse Mehrheit der Buerger geht das Leben weiter wie immer. Aber was wuerde in einem hypothetischen Szenario passieren, in dem nicht nur Kasinos fuer einander haften, sondern auch Baeckereien, Autowerkstaetten, Supermaerkte und alle anderen Betriebe finanziell vernetzt sind und alle fuer einander haften? Jetzt werden im Schadensfall womoeglich nicht nur Kasinos, sondern ausnahmslos alle in den Abgrund gerissen.
Vernetzung ist also gefaehrlich. Wenn ich mein finanzielles Schicksal an Deines kopple, dann bedeutet Dein Bankrott moeglicherweise auch meinen Ruin. Glass-Steagall hat einen Beitrag geleistet, Vernetzung zwischen Banken zu begrenzen. Die Einlagen der Kunden wurden abgeschottet und durften nicht am Investmentkasino teilnehmen. Es war ein Stueck Sicherheit fuer uns alle. Deshalb haben die Banken ja auch so viel in die Lobbyarbeit investiert, dass dieses Gesetz zuruckgenommen wurde.
Ich denke bei der Multikausalität sind wir uns einig. Aber gerade daher ist Sanders‘ Fixierung auf Glass-Steagal nur bedingt hilfreich.
Sanders hat sich nie ausschliesslich auf Glass-Steagall fixiert. Er unterstuetzt auch weitergehende Vorhaben. So moechte er z.B. die Aufspaltung der maechtigen Bankengiganten in kleinere, autonomere Einheiten erzwingen.
Aber andersrum ist die Frage interessant. Weshalb kaempft Hillary denn eigentlich so vehement dafuer, dass die Banken auch in Zukunft die Ersparnisse ihrer Kunden an den Finanzmaerkten verzocken duerfen? Wieso ist ihr das so wichtig? Weshalb bekaempft sie so vehement Sanders‘ Idee die grossen „too big to fail“-Banken in kleinere Einheiten aufzuspalten, die nicht mehr systemrelevant waeren? Weshalb ist ihr das so wichtig? Welchen Vorteil ziehen wir als Gesellschaft eigentlich aus dem Aufblasen eines politisch immer maechtigeren Finanzapparats; aus Banken, die heute bereits maechtiger sind als mittelgrosse Staaten; aus Institutionen, die mit massiven Wahlkampfspenden, lukrativen Jobs und sechststelligen Rednerhonoraren Politiker und Wahlen kaufen?
Mir wäre neu, dass sie „vehement dafür“ kämpft. Nur wenn mich nicht alles täuscht, braucht es für die von Sanders vorgeschlagenen Maßnahmen Gesetze, die nur der Kongress machen kann.
Aber braucht Hillary den Kongress fuer die Umsetzung ihres eigenen Plans nicht?
Hillarys Pläne sind kleinschrittiger und lassen sich zu einem guten Teil mit Executive Actions machen, bzw. wird sie die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente kennen und einsetzen. Bei Sanders ist das deutlich zweifelhafter.
Bisschen spät, aber danke für den Artikel 😉
Es gab ja neulich einen Artikel in der SZ (ich meine, da kommt man nur über Blendle ran), in dem auch Frauen im Wahlkampf analysiert wurden, hauptsächlich Rheinland-Pfalz, weil da zwei Frauen Konkurrentinnen waren. Es ist schon erschreckend, wie schmal der Grat für Frauen ist. Clinton (oder jede andere Frau) könnte auch nie so einen aggressiven Wahlkampf wie Trump führen, die wäre sofort als hysterisches Weibsbild verschrien. Ich habe schon größten Respekt davor, sich dem überhaupt zu stellen. Mich würde das wahnsinnig machen, wenn man mich entweder ständig als zu emotional oder zu kühl bezeichnen würde.
Ich glaube aber, sie hat insofern Glück, weil der Zeitpunkt gut ist und Trump insofern auch ein guter Gegner. Wenn sie einfach souverän und sachlich bleibt, ist sie der ideale Gegenpol zu den Verrücktheiten auf der anderen Seite. Für sie ideal, denn sie ist nun imo wahrlich keine Kandidatin, die jetzt die große Begeisterung und Fantum auslöst. Insofern finde ich sie Merkel btw ziemlich ähnlich. Es wird interessant sein zu sehen, wie es läuft, wenn sie wirklich ins Amt kommt und ich denke, sie wird auch einen guten Job machen.
Stimme zu. Und hey, besser spät als nie. 😉 Und Clinton bleibt noch eine Weile relevant.