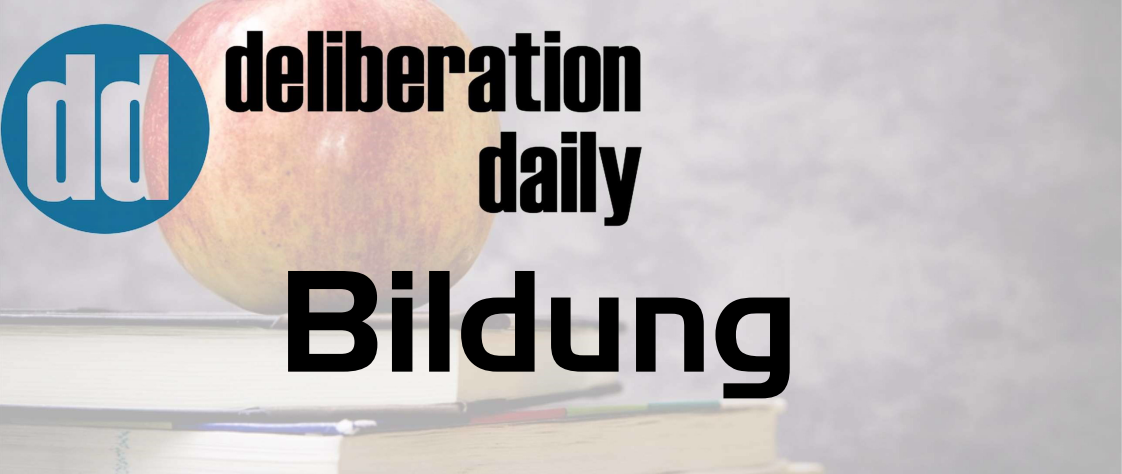 Der allgemeine Verfall, der Niedergang der Bildung und die im Vergleich zur guten alten Zeit generell mangelhaften Fähigkeiten der heutigen Schüler sind beliebte Themen, die zu jeder Zeit schnell hochgekocht werden können. Auch eine aktuelle Studie schein dazu wieder Anlass zu geben – aber die Apologeten des Untergangs irren sich.
Der allgemeine Verfall, der Niedergang der Bildung und die im Vergleich zur guten alten Zeit generell mangelhaften Fähigkeiten der heutigen Schüler sind beliebte Themen, die zu jeder Zeit schnell hochgekocht werden können. Auch eine aktuelle Studie schein dazu wieder Anlass zu geben – aber die Apologeten des Untergangs irren sich.
Der aktuelle Anlass ist die Aktualisierung einer Studie des Gießener Linguisten Wolfgang Steinig, der die Schreibfähigkeiten von Viertklässlern 1972, 2002 und 2012 untersucht hat. Von den Medien aufgegriffen wird vor allem der Anstieg von Rechtschreibfehlern; auf 100 Worte kamen 1972 noch rund sieben Rechtschreibfehler, 2002 zwölf und 2012 sind es siebzehn.
Der Befund selbst wirkt tatsächlich krass und lässt die Kassandra-Rufe all der Sprachschützer und Bildungsnörgler, des Philologenverbands und der Nostalgiker wahr erscheinen: die Jugend verroht! Keine Rechtschreibung mehr, das muss der Anfang vom Ende sein. RTL und die SMS, Twitter und Facebook haben unsere Kinder in den Klauen und vernichten den letzten Rest an bildungsbürgerlichem Ethos. Wenn man die Studie, die online in Auszügen verfügbar ist, aber tatsächlich einmal ansieht stellt man schnell fest, dass alles halb so wild ist.
Die Studie bestand darin, dass Viertklässler einen kurzen Film sehen und dann eine Schulstunde darüber schreiben sollen. Einen genaueren Arbeitsauftrag erhalten sie nicht, die Ergebnisse weichen also stark voneinander ab. Der Spiegel macht bereits einen ungewöhnlich guten Job darin, die Studie genauer unter die Lupe zu nehmen. Er konzentriert sich nicht nur auf die scheinbar schrecklichen Maßgabe der Verdopplung der Rechtschreibfehler in den letzten 40 Jahren. Denn die Studie selbst untersucht noch einige Faktoren mehr als nur die reine Häufigkeit von Rechtschreibfehlern; so geht es unter anderem um das Schriftbild, die Wahl des Schreibwerkzeugs und relativ tiefgehende soziologische Untersuchungen, die das Bild deutlich tiefer machen, als das an der Oberfläche den Anschein hat.
Sieht man etwas genauer hin, fallen weitere Verschiebungen zwischen 1972 und 2012 auf:
- Die Häufigkeit der Fehler korreliert in einem wesentlich stärkeren Ausmaß als früher mit dem sozialen Status der Eltern. Kinder aus der Unterschicht machen wesentlich mehr Fehler als Kinder aus der unteren und oberen Mittelschicht.
- Das schöne Schreiben spielt, anders als 1972, seit den späten 1980er Jahren in der Schule praktisch keine Rolle mehr. Wurde es 1972 noch exzessiv in den Lehrplänen thematisiert, inklusive der Wahl des Schreibwerkzeugs (beginnen mit Bleistift, dann zum Füller übergehen), so wird es heute nicht mehr geregelt.
- Während 1972 die Mehrheit der Texte Berichte waren, waren sie 2002 Erzählungen, während es 2012 Kommentare und Kritiken sind. Noch einmal: es gab keinen genauen Arbeitsauftrag außer „schreibt darüber“. Die Form war nicht vorgegeben.
- Analog zur Verbreiterung des Abstands zwischen den sozialen Schichten hat sich der zwischen Migranten und Muttersprachlern deutlich verringert. Die Fehlerzahl von Migrantenkindern weicht nur noch marginal vom Durchschnitt ihrer jeweiligen Schicht ab, hält sich jedoch an deren Rahmen.
- Der Wortschatz der Kinder hat sich seit 1972 erheblich erweitert; die Varianz schwankt zwischen dem Doppelten und dem Vielfachen des 1972 gemessenen Wortschatzes und weist zudem eine Tendenz in Richtung Schriftsprache auf; 1972 noch übliche Verschriftlichungen von Umgangssprache (etwa „schmeißen“ statt „werfen“) sind deutlich zurückgegangen.
- Überhaupt nicht verschoben hat sich das Gefälle zwischen den Geschlechtern: Mädchen machen im Schnitt weniger Fehler und schreiben schöner als die Jungen.
Diese Ergebnisse sind alle in höchstem Maße relevant, wenn man die Ergebnisse der Studie einordnen will und nicht nur mit der – zugegeben dramatischen – Verdopplung der Rechtschreibfehler in die Schlagzeilen hieven möchte.
Es handelt sich keinesfalls um ein skandalöses Versagen des Bildungssektors
Das offensichtlich größte Versagen des Bildungssektors findet seinen Ausdruck in der weiten Öffnung der sozialen Schere. Kinder aus den viel zitierten bildungsfernen Haushalten schneiden wesentlich schlechter ab als Kinder, die aus der Mittelschicht stammen. Diese Diskrepanz ist ein Symptom der generellen Verschiebung, die zwischen 1972 und 2012 zu beobachten ist. Diese Verschiebung ist es, die die Interpretation rechtfertigt, dass die Ergebnisse eigentlich sehr positiv und keinesfalls als skandalöses Versagen des Bildungssektors zu werten sind. Woher kommt das?
Die Antwort ist, dass das Bildungssystem keineswegs weicher und weniger anspruchsvoll ist als früher (eine Interpretation, die sich häufig findet und gerne unter dem Kampfbegriff „Kuschelpädagogik“ verschrieen wird). Stattdessen wird den Schülern wesentlich mehr abverlangt, was das eigene Denken anbelangt, und weniger, was Disziplin- und Fleißaufgaben anbelangt. Es hat seit 1972 einen Paradigmenwechsel in der Bildungspolitik gegeben: Statt „Stoff“ lernen Schüler mittlerweile „Kompetenzen“. Das Bild des Schülers hat sich von einem vom Lehrpersonal erzieherisch und didaktisch zu füllenden Gefäß hin zu einem eigenständig denkenden und lernenden Individuum verschoben, das den Lehrer hauptsächlich als „Lernbegleiter“ nutzt, der ihm Kompetenzen vermittelt, mit denen das Kind den „Stoff“ selbst lernen kann. An dieser Stelle soll nicht diskutiert werden, wie erfolgreich dieses Modell in der Realität ist (und sein kann), aber es ist als Zielanspruch der Bildungspolitik spätestens seit 2004, in der Vorstellung führender Didaktiker und Pädagogen aber schon wesentlich länger Realität.
Sowohl das „schöne Schreiben“ (das früher noch benotet und exzessiv geübt wurde) als auch Rechtschreibung sind Dinge, die man vor allem durch Übung erlernt und die einem klaren Richtig-Falsch-Muster gehorchen: Die Schüler setzen Anweisungen des Lehrers um und lernen Regeln auswendig. Dieser Schritt wird so oft wiederholt, bis die Lektion gelernt ist. Forscher Steinig vermutet, dass zu der Entscheidung über die weiterführende Schulform das Schriftbild maßgeblich beiträgt, weil die Lehrer automatisch Vorurteile über den Schreiber davon ableiten. Dies mag durchaus eine Rolle spielen, sollte aber nicht überinterpretiert werden.
Die Paradigmenverschiebung in der Bildungspolitik
Diese Paradigmenverschiebung in der Bildungspolitik erklärt auch die soziale Schere. Im Vergleich zu 1972 gibt das Schulsystem 2012 wesentlich mehr Verantwortung an Schüler und Eltern ab. Wo die Schule weniger Wert auf Dinge legt (und diese eintrainiert und mit Zensuren bewertet) die einfach auswendig gelernt und geübt werden können, sind die Schüler mehr gefordert. Vor allem sind sie völlig anders gefordert als das noch ihre Eltern waren. Dinge wie Rechtschreibung werden zwar immer noch behandelt, aber längst nicht mehr so ausführlich wie früher. Stattdessen sind andere Themenkomplexe in den Vordergrund gerückt.
Das heißt aber auch, dass sich Lücken schnell und schwerwiegend äußern. Wenn in der Schule mehr gelernt wird als früher, oder doch zumindest anders, dann ist automatisch weniger Zeit für die Dinge, die in der Abwesenheit des Neuen früher mehr Raum hatten – etwa Rechtschreibung und Schönschreiben. Wenn ein Schüler diese Dinge nicht erfasst, wenn sie besprochen werden oder sie direkt selbstständig nacharbeitet (was bei Grundschülern mit Sicherheit heißt: mit den Eltern), wird er das Defizit ständig mitschleppen.Dieses Grundproblem der Schule – dass Defizite kaum mehr aufgearbeitet werden können – hat früher erst in der weiterführenden Schule eingesetzt, meist mit der Pubertät in der Mittelstufe. Inzwischen scheint es bereits früher einen Effekt zu haben. Das Versagen des staatlichen Schulsystems besteht darin, keine Möglichkeiten zum Aufholen dieser Defizite zu bieten. Man muss fairerweise sagen, dass sich die Situation in den letzten Jahren bereits gebessert hat, aber wie so oft hängt es an der Finanzierung. Schulische Angebote zur Vertiefung und Wiederholung brauchen Deputatsstunden, und an denen wird in Zeiten klammer Haushalte gespart (und wann haben wir diese Zeiten nicht?).
Entsprechend zeigt sich die Schere zwischen arm und gut situiert auch deutlicher. Wohlhabende Eltern kommen meist bereits aus einem entsprechenden bildungstechnischem Hintergrund und können die Probleme, Defizite und Chancen ihrer Kinder wesentlich besser erfassen und im Zweifelsfall private Nachhilfe bezahlen. Arme Eltern kommen meist aus bildungsfernen Haushalten. Sie haben keine Erfahrung mit dem, was ihre Kinder tun und können ihnen kaum Hilfestellung bieten. Ihnen fehlt außerdem das Geld für privaten Nachhilfeunterricht.Diese Lücke muss unbedingt geschlossen werden, und das wird sich nur durch Investitionen ins Schulsystem lösen lassen, vor allem die Einstellung von mehr Lehrern, so dass Deputatsstunden für Intensivierung und Wiederholung freigemacht werden können und nicht durch den Regelunterricht komplett aufgebraucht werden. (In diesem Zusammenhang ist auch noch einmal interessant zu sehen, dass das Bildungssystem nicht ethnisch diskriminiert, wie das früher der Fall war: ob ein Kind Muttersprachler ist oder Migrationshintergrund hat ist irrelevant; wichtig ist das Vermögen der Eltern.)
Schüler lösen heute wesentlich komplexere Aufgaben als 1972
Um diese reichlich theoretische Paradigmenverschiebung am Beispiel deutlicher zu machen, sei noch einmal die Studie selbst herangezogen. Die Lehrer legen wenige Gewicht als früher auf Rechtschreibung und stattdessen mehr aufs Lesen (das wundert auch nicht, denn die Bildungspolitik hat nach den durch PISA, TIMMS und Co aufgedeckten Defiziten hier besondere Schwerpunkte gesetzt). Obwohl natürlich auch durch den passiven Sprachgebrauch die Rechtschreibfähigkeiten besser werden (man sieht die Worte ja „richtig“), ist das nicht so effizient wie das Auswendiglernen von Regeln. Stattdessen aber erweitert dieser Fokus den Wortschatz beträchtlich, was die Studie ja auch belegt. Gleichzeitig ging das produktorientierte Arbeiten, also der Unterricht mit dem Ziel, am Ende irgendein Produkt zu haben (etwa einen fertigen Text; ein ausgefülltes Arbeitsblatt mit Rechtschreibregeln ist kein Produkt) den Weg weg vom reinen Wiedergeben von Dingen, die man gesehen oder gelesen hat und hin zu einer Reflexion – eine wesentlich komplexere Aufgabe, als dies 1972 der Fall gewesen war.
Man kann bedauern, dass auf dem Weg zu diesem Ziel die Rechtschreibkompetenzen gelitten haben. Gleichzeitig aber kann man sich darüber freuen, dass die Schüler nicht nur wesentlich bessere Texte schreiben (mit einer komplexeren Syntax und Wortwahl), sondern dass sie auch in der Lage sind, anspruchsvollere Texte zu schreiben, als dies noch 1972 der Fall gewesen ist. Das reine Lernen von Stoff und das folgende Wiedergeben von Gelerntem ist zu Recht aus den Bildungsplänen (die entsprechend auch nicht mehr Lehrpläne heißen) verbannt worden. Stattdessen versucht Schule heute, die Schüler zum eigenständigen Denken und Arbeiten zu erziehen – ein hehres Ziel, dessen Umsetzung sicher noch zu wünschen übrig lässt und nicht in allen Facetten funktioniert; die klare soziale Schere ist nur eines von mehreren Problemen auf diesem Feld. Eines aber ist dieser Paradigmenwechsel sicher nicht: ein Verlust von Qualität in der Bildung. Ich für meinen Teil korrigiere lieber ein paar Rechtschreibfehler mehr, wenn ich im Gegenzug eine qualitativ hochwertige Arbeit bekomme, die inhaltlich mehr zu bieten hat als eine reine Wiedergabe dessen, was ich den Schülern in den Wochen vorher beigebracht habe. Es ist anstrengender und fordernder für die Schüler als einfach nur zu parieren und auswendig zu lernen, aber mir wäre neu, dass das etwas Schlechtes ist.

