Ich komme gerade aus vielerlei Gründen nicht dazu, für alle Dinge, die ich lese, eigene Rezensionen zu erstellen. Deswegen lasse ich eine alte Tradition wieder aufleben und erstelle hier eine Übersicht über einige Titel, die ich in der letzten Zeit gelesen habe, mit einigen Anmerkungen. Die Titel dieser Liste wurden von Juni bis September 2025 gelesen. Alle Links führen zu Amazon; wenn ihr darüber bestellt, erhalte ich einen kleinen Anteil. Damit genug der Vorrede, los geht’s.
Alexander Thiele – Das Grundgesetz
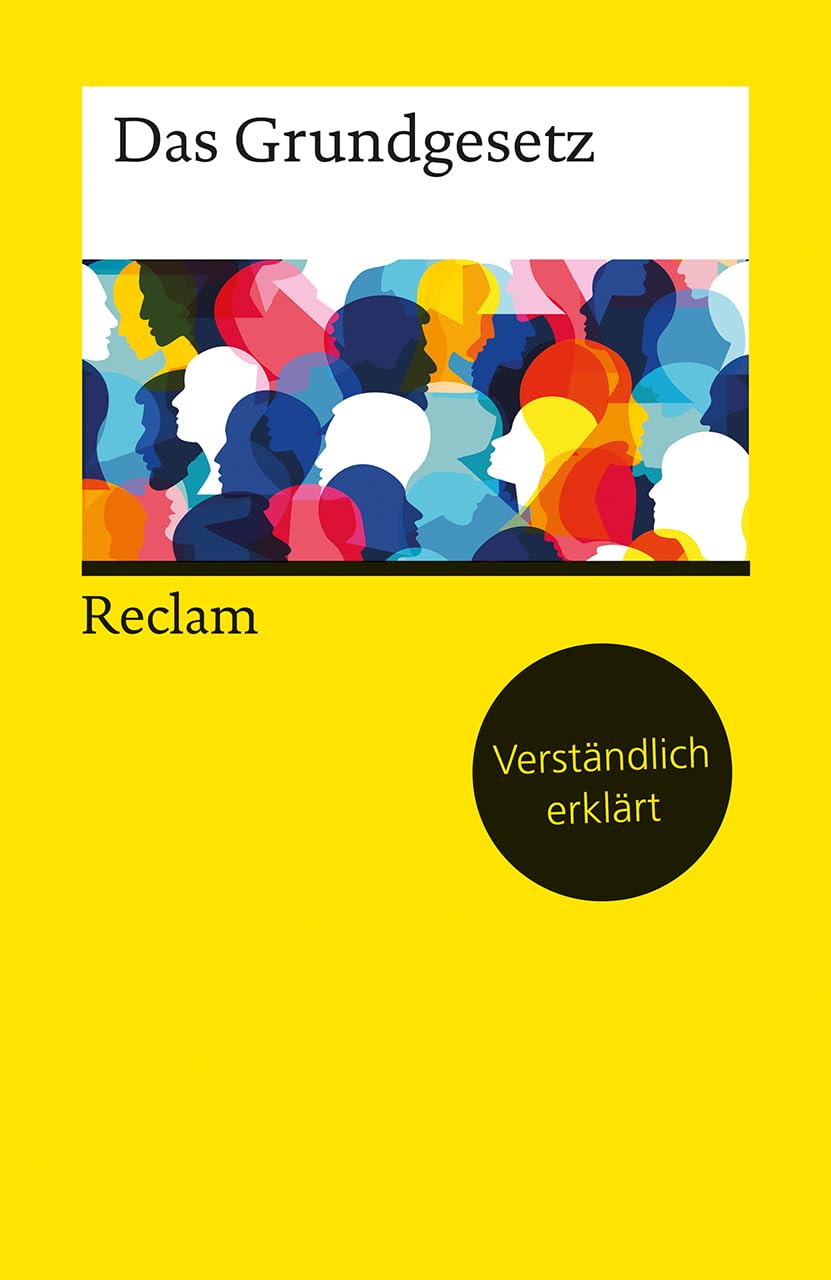 Neben Möllers Werk „Das Grundgesetz“ (2023 hier rezensiert, 2025 hier besprochen) habe ich mich dieses Jahr auch mit einem Werk von Alexander Thiele auseinandergesetzt. Sein struktureller Ansatz ist etwas anders als Möllers. Wo letzterer vor allem eine historische und allgemeine Betrachtung unternimmt, verfasst Thiele eher einen juristischen Kommentar für Laien: neben dem vollen Text des Grundgesetzes, der für ein kurzes Nachblättern sehr praktisch ist und bei Möllers auch hilfreich gewesen wäre, erläutert er die Funktion wichtiger Artikel und setzt sie in einen Kontext. Da die Artikel für Laien nicht immer gleich eingängig und verständlich sind, ist das eine wertvolle Hilfe.
Neben Möllers Werk „Das Grundgesetz“ (2023 hier rezensiert, 2025 hier besprochen) habe ich mich dieses Jahr auch mit einem Werk von Alexander Thiele auseinandergesetzt. Sein struktureller Ansatz ist etwas anders als Möllers. Wo letzterer vor allem eine historische und allgemeine Betrachtung unternimmt, verfasst Thiele eher einen juristischen Kommentar für Laien: neben dem vollen Text des Grundgesetzes, der für ein kurzes Nachblättern sehr praktisch ist und bei Möllers auch hilfreich gewesen wäre, erläutert er die Funktion wichtiger Artikel und setzt sie in einen Kontext. Da die Artikel für Laien nicht immer gleich eingängig und verständlich sind, ist das eine wertvolle Hilfe.
Das gilt besonders, wenn wir den eher bekannten Bereich der Grundrechte verlassen und eher in die strukturellen Bereiche gehen, die etwa den Föderalismus definieren oder die Finanzfragen regeln. Das Grundgesetz ist in seinem Aufbau wirklich nicht der eindeutigste Text, und die vielen Änderungen seither haben es nicht eben leichter gemacht, hier durchzusteigen, so dass die entsprechenden Kommentare und Verweise auf Grundsatzurteile sehr sinnvoll sind, um ein tieferes Verständnis zu erlangen.
Auffällig fand ich, wie sehr sich Möllers und Thieles Einschätzung ähnelten, besonders, was die missglückte Sprache der zahlreichen neueren Grundgesetzänderungen (besonders des Asylparagrafen oder der Schuldenbremse) und die generelle Tendenz, genuin politische Kompromisse mit Verfassungsrang zu veredeln, angeht. Auch die nicht zu unterschätzende Wirkung des BVErfG bei der Schaffung der heutigen Verfassungsrealität, die bei weitem nicht automatisch war, oder die Festsetzungen der frühen Adenauer-Ära finden hier ihren Niederschlag. Thiele hat darüber ja in seinem Buch „Machtfaktor Karlsruhe“ (hier rezensiert) geschrieben, und ich habe mit ihm im Podcast darüber gesprochen.
Suzanne Rowntree – How to write a fantasy battle
 Fantasy-Schlachten sind für Historiker*innen immer Ereignisse in den entsprechenden Geschichten, die nicht sonderlich akkurat und oftmals von reichlich blödsinnigen Entscheidungen der Protagonist*innen geprägt sind (looking at you, Jon Snow). Suzanne Rowntree ist zwar keine Historikerin, versichert uns aber, sich über ein Jahrzehnt lang intensiv mit der Militärgeschichte des Mittelalters mit besonderem Schwerpunkt auf den Kreuzzügen beschäftigt zu haben und sieht sich deswegen kompetent genug, Fantasy-Autor*innen ein Werk an die Hand zu geben, mit dem sie glaubhaftere Fantasyschlachten schreiben können. Als jemand, der das allein für das P&P-Rollenspielhobby immer wieder tut, war das für mich natürlich entsprechend von Interesse.
Fantasy-Schlachten sind für Historiker*innen immer Ereignisse in den entsprechenden Geschichten, die nicht sonderlich akkurat und oftmals von reichlich blödsinnigen Entscheidungen der Protagonist*innen geprägt sind (looking at you, Jon Snow). Suzanne Rowntree ist zwar keine Historikerin, versichert uns aber, sich über ein Jahrzehnt lang intensiv mit der Militärgeschichte des Mittelalters mit besonderem Schwerpunkt auf den Kreuzzügen beschäftigt zu haben und sieht sich deswegen kompetent genug, Fantasy-Autor*innen ein Werk an die Hand zu geben, mit dem sie glaubhaftere Fantasyschlachten schreiben können. Als jemand, der das allein für das P&P-Rollenspielhobby immer wieder tut, war das für mich natürlich entsprechend von Interesse.
Leider war die Lektüre bei aller Kürze (das kostengünstige Bändchen kommt auf keine 100 Seiten) reichlich enttäuschend. Rowntree hängt eine Reihe von willkürlichen Erklärungen aneinander, deren Relevanz sie zudem durch ständige anachronistische wie bereits veraltete und reichlich einseitig gestimmte Vergleiche mit dem Ukrainekrieg anreichert (ja, Aufklärung ist wichtig, und sowohl englische Langbögen als auch Drohnen dominierten mal das Schlachtfeld). Vor allem aber fallen selbst mir, der wahrlich kein Experte für mittelalterliche Militärgeschichte ist, zahlreiche Unstimmigkeiten oder doch wenigstens grobe Vereinfachungen auf.
So ordnet Rowntree mittelalterliche Armeen in Infanterie, Kavallerie und Artillerie (!), als ob Belagerungsmaschinen einen Einsatz auf dem Schlachtfeld gefunden hätten. Auch ist die Vorstellung klar organisierter Truppenarme deutlich von der neuzeitlichen Heeresorganisation her geprägt. Angesichts der Länge ihres Werks kann sie außerdem kaum vermeiden, das übliche populärwissenschaftliche Problem der Mittelalter-Geschichtsschreibung zu reproduzieren, eine Epoche von 1000 Jahren Dauer und sich über zahlreiche disparate Kulturräume erstreckender Vielfalt auf „das Mittelalter“ zu reduzieren, als ob die Kriegsführung der Franken um 800 sich nicht großartig von den Kreuzzügen in Palästina oder der Reconquista im Spätmittelalter unterschieden hätte.
Das größte Problem des Werks aber ist, dass über all die anekdotenhafte Erklärung von mittelalterlicher Kriegsführung das eigentliche Thema das Buches überhaupt nicht gewürdigt wird: wie man eine Fantasyschlacht schreibt. Es ist ja schön und gut, dass in realen Kriegen, auch im Mittelalter, Planung alles war, man Feldschlachten wegen der Gefahren zu vermeiden und das Element der Überraschung zu bewahren suchte. Nur sind lange Planungssitzungen und Logistik genauso wenig der Stoff spannender Finale wie ein Überraschungsangriff auf die feindliche Vorhut oder das geschickte Ausmanövrieren eines Gegners. Wie sich die Erkenntnisse über „reale“ Kriegsführung zu den Erfordernissen literarischer Spannung verhalten wäre ja genau die spannende Frage, an der eine fruchtbare Synthese stattfinden könnte, doch passiert genau dieses nicht.
Carol J. Clover – Men, Women and Chainsaws: Gender in Modern Horror Films
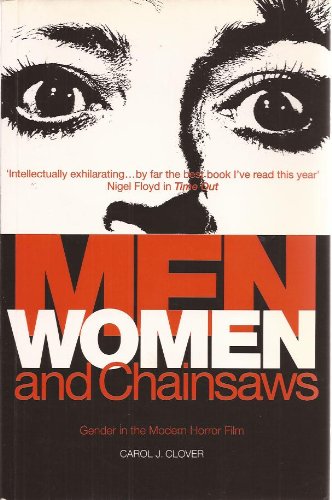 Horrorfilme sind ein Genre, mit dem ich persönlich wenig anfangen kann. Ich habe ein paar wenige gesehen, aber ich habe einfach zu große Angst vor den Dingern, selbst bei so harmlosen Sachen wie „Final Destination“ oder so. Als kulturelles Phänomen aber finde ich sie interessant. Ein Klassiker der Betrachtung ist das vorliegende „Men, Women and Chainsaws“, das 1991 erschien und hier mit einem überarbeiteten Vorwort der Autorin vorliegt.
Horrorfilme sind ein Genre, mit dem ich persönlich wenig anfangen kann. Ich habe ein paar wenige gesehen, aber ich habe einfach zu große Angst vor den Dingern, selbst bei so harmlosen Sachen wie „Final Destination“ oder so. Als kulturelles Phänomen aber finde ich sie interessant. Ein Klassiker der Betrachtung ist das vorliegende „Men, Women and Chainsaws“, das 1991 erschien und hier mit einem überarbeiteten Vorwort der Autorin vorliegt.
Das Alter des Buchs – immerhin rund 30 Jahre – macht die Lektüre teilweise redundant, weil viele Dinge, die hier besprochen werden, nicht mehr zutreffen. So ist Horror für Clover ein männlich dominiertes Genre, mit Männeranteilen von >90% im Publikum. In den 1970er und 1980er Jahren, die sie untersucht, mag das auch durchaus zutreffend gewesen sein. Inzwischen aber hat sich das Verhältnis grob bei 50:50 eingependelt, bei manchen Subgenres sogar mit einem deutlich weiblichen Übergewicht. Ich kann das auch aus persönlich-anekdotischer Evidenz bestätigen; bei uns in der Familie ist meine Frau die Horror-Guckerin, nicht ich Weichei.
Aber damit zum Werk selbst. Clovers Grundlagenforschung ist, wenn man sie nicht als umfassenden Überblick des Genres, sondern als eine Betrachtung der Anfänge des Genres und damit als historischen Abriss begreift, weiterhin sehr relevant. Sie teilt verschiedene Genres ein, untersucht Tropen wie das „Final Girl“ und betrachtet den Appeal des Genres generell. Ihre Betrachtungen enthalten mittlerweile weithin bekannte Feststellungen etwa dazu, dass das Publikum sehr „genre-savvy“ ist; ein Effekt, der mittlerweile im Mainstream angekommen ist, wie wir hier im Podcast ja auch schon diskutiert haben. Tropen-Kenntnis ist weit verbreitet.
Aber der größte Teil des Buches ist eine Verbindung der Filmanalyse mit den Gender Studies, indem Clover sich besonders mit Männer- und Frauenrollen beschäftigt. Spätestens seit „Scary Movie“ ist einem breiten Publikum bekannt, dass Sex zu haben in Horrorfilmen einem Todesurteil gleichkommt. Clover beschäftigt sich aber auch mit dem Effekt der Entmännlichung, der vor allem ab den 1980er Jahren zunimmt (indem Männer den Horror nicht bezwingen können, sondern auf häufig emaskulierende Weise Opfer werden) oder mit der Übernahme männlicher Rollen durch die „Final Girls“, die mit Gewalt die Quelle des jeweiligen Horrors beseitigen. Sehr unangenehm wird die Lektüre, wo es um die Rape-Revenge-Horror-Filme geht, in denen eine Vergewaltigung der „inciting incident“ ist. Vielleicht liegt es an meiner geringen Kenntnis des Genres, aber ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile nicht mehr gemacht wird; in den 1980er Jahren war es erschütternd verbreitet.
Insgesamt ist das Werk immer noch lesenswert, wenn man sich für die Thematik interessiert, vor allem wegen der Gender-Untersuchungen. Leider sind die angestaubten Referenzen dahingehend problematisch, als dass es vor allem ein historischer und wenig ein aktueller Einblick ist. Dafür ist das Ding im Audible-Abo enthalten und kostet keinen Cent, das ist ja auch was.
 Der Alltag im Römischen Reich ist gegenüber den Geschichten von Kaisern und Legionären ein häufig unterbelichteter Faktor in der öffentlichen Wahrnehmung. Alberto Angela nimmt es auf sich, das in seinem flott geschriebenen und gut lesbaren Werk zu ändern. Der narrative Rote Faden eines Rundgangs durch das Römische Reich etwa zur Zeit Trajans ist ein Sesterz, der seinen Weg durch zahlreiche Hände nimmt und dabei quasi das gesamte Römische Reich durchwandert. In der Theorie lassen sich so zahlreiche soziale Situationen abbilden, denn Geld stinkt bekanntlich nicht und schert sich nicht darum, wer es ausgibt – ob titelgebender Kaiser oder Hure.
Der Alltag im Römischen Reich ist gegenüber den Geschichten von Kaisern und Legionären ein häufig unterbelichteter Faktor in der öffentlichen Wahrnehmung. Alberto Angela nimmt es auf sich, das in seinem flott geschriebenen und gut lesbaren Werk zu ändern. Der narrative Rote Faden eines Rundgangs durch das Römische Reich etwa zur Zeit Trajans ist ein Sesterz, der seinen Weg durch zahlreiche Hände nimmt und dabei quasi das gesamte Römische Reich durchwandert. In der Theorie lassen sich so zahlreiche soziale Situationen abbilden, denn Geld stinkt bekanntlich nicht und schert sich nicht darum, wer es ausgibt – ob titelgebender Kaiser oder Hure.
In der Praxis aber hat mich das Werk eher enttäuscht. Zwar liest es sich ganz angenehm, aber auch der Verweis auf irgendwelche Quellen wie Tacitus oder Livius kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir hier ein sehr populärwissenschaftliches Werk vor uns haben, das zwar 2013 erschienen sein mag, aber definitiv nicht auf dem Stand der Wissenschaft dieses Jahres steht. Auf einer gewissen Ebene kann das auch nicht sein; „das Römische Reich“ ist eine ähnlich sinnvolle Kategorie wie „das Mittelalter“, weswegen es auf seinem Höhepunkt zur Zeit Trajans vor allem durch seine Klischeedichte überzeugen kann.
Zwar gibt sich Angela durchaus Mühe, eine gewisse historische Authentizität zu erreichen, aber spätestens, wenn er völlig unkritisch die Zahlen der römischen Quellen übernimmt, wird es mir zu bunt. Natürlich, die Römer haben in Boudiccas Aufstand 70.000 Gegner erschlagen, klar. Boudicca hatte mit Sicherheit eine Armee, die etwa 350.000 Krieger und damit mehr Truppen als das ganze Heer zu Augustus‘ Zeiten umfasste. Das ist nur ein Beispiel. Da hilft es dann auch nicht, wenn er mit dem Verweis darauf, dass ein Dekurio staunend vor einer Maschine steht, von der wir nicht genau wissen, was sie ist, und fröhlich drauf losspekuliert, ob es eine Waschmaschine gewesen sein könnte, nur um festzustellen, dass das angesichts der involvierten Mengen keinen Sinn machen würde. Die Zahl der Beispiele ist Legion. Von dieser Lektüre mag ich daher eher abraten; es gibt bessere Werke zur römischen Geschichte, die auch für interessierte Laien zugänglich sind.

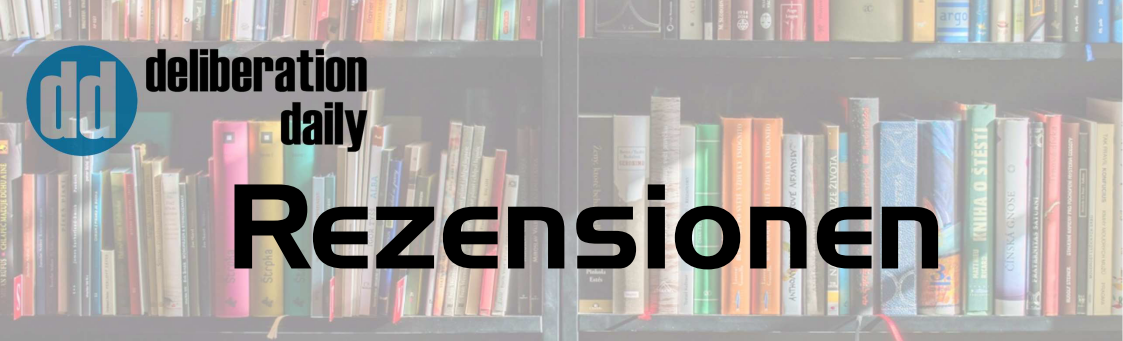


1) „Fantasy battle“ – Ich möchte argumentieren, dass Rowntree für Militärdoktrin das einbringt, was für andere Gesellschaftsbereiche bereits gang und gäbe ist und von dir durchaus positiv rezipiert wird: Die Rückprojektion moderner Vorstellungen (etwas in Bezug auf Geschlechterrollen oder ‚Diversitäten‘) auf eine pseudohistorische Welt.
2) „Fantasy battle“ zum zweiten – Du fällst mit der Aussage „… als ob Belagerungsmaschinen einen Einsatz auf dem Schlachtfeld gefunden hätten.“ genau in die Falle, die du zwei Sätze später erklärst. Das Mittelalter ist eine lange Zeit und in der letzten Phase wurde Feldartillerie eingesetzt – etwa die Tarasnice und Hawicza, mit denen in den Hussitenkriegen Jan Zizka seine Wagenburgen verteidigte.
3) „Chainsaws“ – Ein interessantes Paradoxon, man könnte argumentieren, dass Clovers Buch selbst dafür gesorgt hat, dass es veraltet ist. Es wurde in den 90ern ziemlich weit rezipiert, und hat dadurch wohl auch dazu beigetragen, dass die Topoi des Horrorgenres in Bezug auf Geschlechter stärker hinterfragt wurden.
4) „Legionäre“ Als Ergänzung und Bestätigung: Alberto Angela ist Wissenschaftsjournalist und betreibt als „Erklärbär“ im italienischen Fernsehen eine (Populär-) Wissenschaftssendung („Ulisse“). Da ist es kein Wunder, dass ein gutes Maß Sensationsgier im Buch steckt.
1) Ihr Anspruch ist aber, historische Realität abzubilden. Daran scheitert sie.
2) Ja, aber von denen redet sie nicht.
3) Good point.
4) Ja.
Alberto Angela:
Habe mir genau das Buch vor etwa 5 Jahren gekauft und war halbwegs angetan. Flüssig geschrieben und mal eine andere Perspektive. Yup, die historischen Ungenauigkeiten (gibt noch deutlich mehr) wären für ein echtes Historikerbuch ein Ausschlussgrund, aber so habe ich es nie gelesen. Dient, könnte ich mir vorstellen, einigen Leuten wie mir als Ergänzung zu historisch akuraterer Lektüre, nicht als Ersatz.
Gruss,
Thorsten Haupts
Ja, da bin ich dabei.