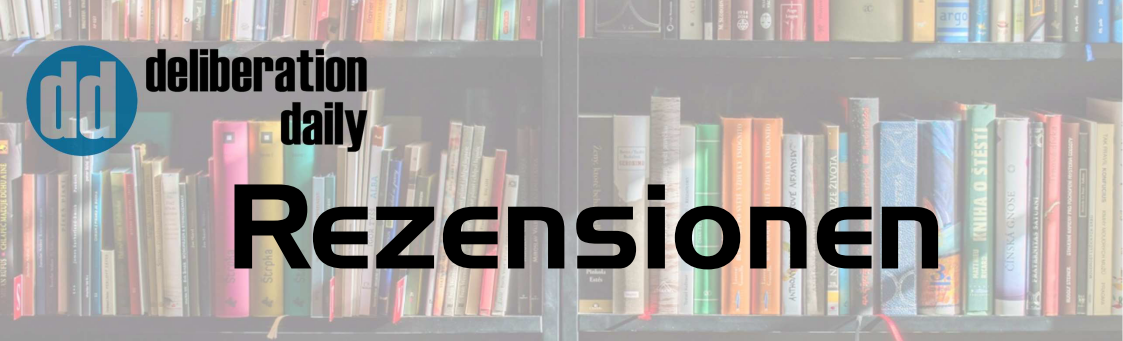Teil 1 hier.
Markus Brechtken – Aufarbeitung des Nationalsozialismus: Ein Kompendium
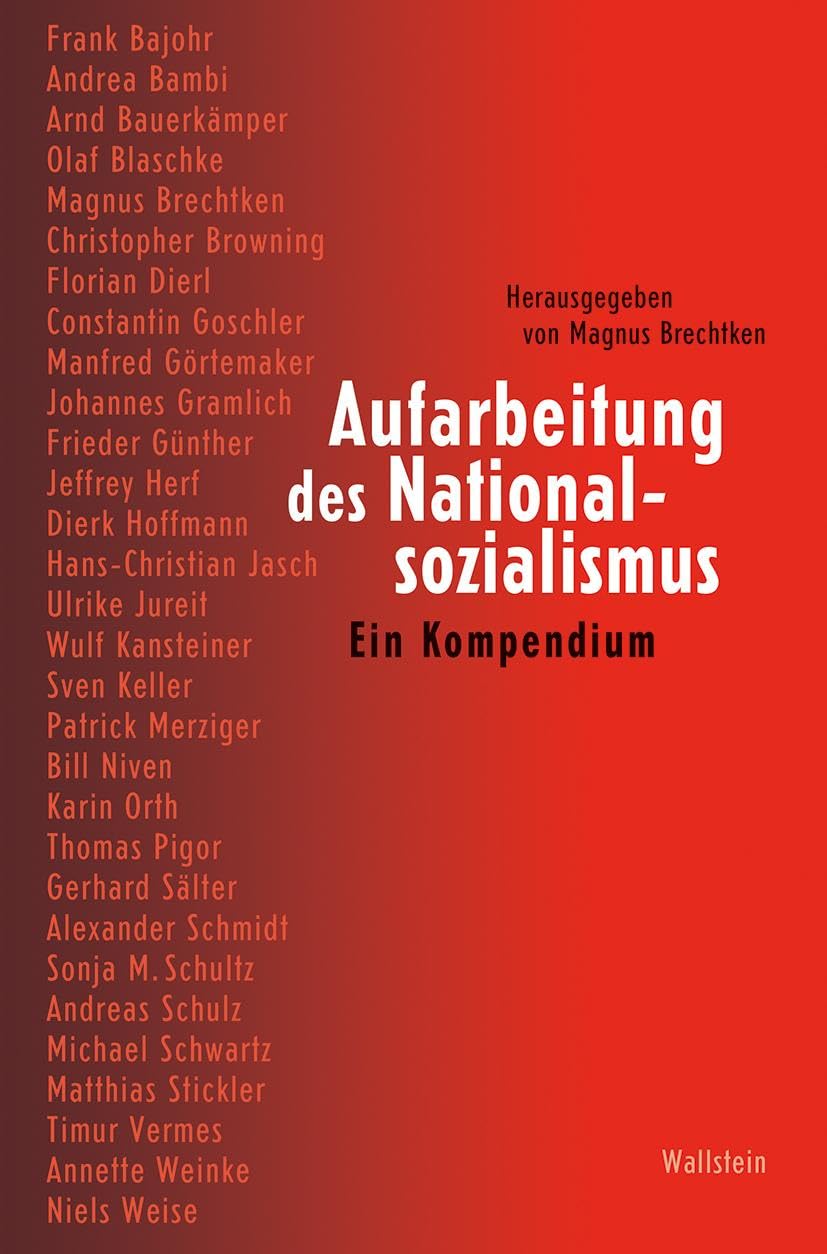
Abschnitt 5, „Funktionäre und politische Akteure„, betrachtet vor allem die eher umstrittenen Akteure in der Vergangenheitsbewältigung; etwas merkwürdig, dass auf die konstruktiv wirkenden Akteure hier kein Blick fällt.
Matthias Stickler macht in Kapitel 13 „Die deutschen Vertriebenenverbände – historiographische Aspekte„, den Anfang, indem er herausarbeitet, wie sich diese einerseits als unbelastet selbst inszenierten und sie gleichzeitig von der DDR-Forschung als Schreck- und Zerrbild gezeichnet wurden (vor allem ab 1982, aber bereits in den 1950er Jahren wurde der Einfluss der Vertriebenenverbände völlig übertrieben), was vor allem deswegen so gut gelang, weil in der Bundesrepublik eine kritische Sichtweise kaum Platz hatte und die Erforschung fehlte. Ein Überblick über die Forschungsgeschichte zu den Verbänden schließt das Kapitel ab.
Diese Thematik wird von Michael Schwarz in Kapitel 14, „Vertriebenenpolitiker in der Bundesrepublik Deutschland. NS-Vergangenheiten und politisches Engagement in der Demokratie„, weiter ausgebaut. Schwarz greift sich einige BdV-Funktionärsbiographien und untersucht anhand von diesen, inwieweit Kontinuitäten zur NS-Ideologie bestanden. Er kann dabei aufzeigen, dass die Verbände zwar eine grundsätzlich national gesinnte und revisionistisch orientierte Linie verfolgten und zu großen Teilen auch völkisch bestimmt blieben, das Bild aber insgesamt differenziert ist und die Breite der Themen – vor allem solchen wie dem sozialen Wohnungsbau – und die Haltung der Funktionäre Anknüpfungspunkte bis tief in die SPD erlaubte, so dass die Verbände bis 1969 und dem Bruch mit der SPD durchaus einen überparteilichen Anspruch behalten konnten. Gleichzeitig war manches Personal wie der baden-württembergische Landesvorsitzende Schmocker so offensichtlich NS-belastet, dass sie von einer Allparteienkoalition an einem Eintritt in die Landesregierung gehindert wurden, bis ein geändertes politisches Umfeld in den 1970er Jahren zu einer vollständigen politischen Integration in die CDU führte. Schwarz beschreibt auch, dass die BdV-Vorsitzenden sich mit dem Argument legitimierten, ihre Mitglieder wenigstens politisch aus den extremen Parteien herauszuhalten und deswegen mit der CDU kooperierten und nicht etwa mit der NPD (auch wenn Einzelmitglieder hier durchaus Sympathien besaßen und kooperierten).
Ein anderes Feld untersucht Andreas Schulz in Kapitel 15, „Braune Parlamentarier? Zur NS-Vergangenheit des Deutschen Bundestags„. Seine Fragestellung ist vor allem, ob „braune Seilschaften“ existierten. Dies ist erstaunlich schwierig zu sagen, weil die Biografien der frühen Bundestage noch nicht durchgehend erforscht sind und die verfügbaren Daten auf Selbstauskünften beruhen und deswegen unzuverlässig sind. Er postuliert aber klar, dass die Abgeordneten zwar allesamt eine Beschäftigung mit der NS-Vergangenheit verhinderten und nach Ende der alliierten Aufsicht auch früheren NS-Funktionären den Weg in den Bundestag ebneten, gleichzeitig aber eine Läuterung der Betroffenen und Integration in den Parlamentarismus stattgefunden habe und NS-Gedankengut keinen Platz hatte.
Abschnitt 6, „Behörden und Auftragsforschung„, befasst sich mit der von Joschka Fischers Außenministerium ausgelösten Welle von behördlicher Auftragsforschung, in denen die Behörden ihre Vergangenheit aufarbeiten ließen.
Den Anfang macht Niels Weise in Kapitel 16, „„Mehr als Nazizählerei“. Die Konjunktur der behördlichen Aufarbeitungsforschung seit 2005„, in dem er beschreibt, wie ausgehend von der Studie des Auswärtigen Amts (die unter dem Titel „Das Amt“ zu einem relativen Bestseller wurde und viel Aufmerksamkeit auf sich zog) nach und nach fast sämtliche Bundesbehörden ihre Vergangenheit untersuchen ließen. Der Umfang und die Zielrichtung der Arbeiten waren dabei jeweils verschieden, weswegen die Ergebnisse nicht zu hundert Prozent vergleichbar sind – das erfordert Meta-Forschung in der Zukunft -, aber der Vorwurf der „Nazizählerei“ wird von Weise klar zurückgewiesen. Die Projekte seien unabhängig und wissenschaftlich sauber gewesen und hätten zahlreiche Erkenntnisse erbracht.
Constantin Goschler vertieft dies in Kapitel 17, „Auftragsforscher im Herzen der Finsternis? Das Geschichtsprojekt zum Bundesamt für Verfassungsschutz im Kontext der jüngeren Aufarbeitungsforschung„, am Beispiel des Verfassungsschutzes. Ironischerweise sei diese Auftragsforschung die bis dato transparenteste gewesen, was zu starker Kritik geführt habe: gerade weil sie transparent war, habe man die Vergabeprozesse überhaupt kritisieren können. Das Ergebnis habe für sich gesprochen, weil der Verfassungsschutz nicht in die Arbeit eingegriffen und weitgehenden Zugriff gewährt habe, der seither schrittweise auch den Archiven zugänglich gemacht werde. Gleichzeitig betont Goschler immer wieder das Spannungsfeld der Geheimhaltungsnotwendigkeit und der offenen Forschung.
Einen anderen Schwerpunkt verfolgt Gerhard Sälter in Kapitel 18, „Professionalität, NS-Belastung und Integration der Staatsbediensteten: Über die Argumentationsfigur des Experten„, in dem er sich der Argumentationsfigur der Behörden annimmt, man habe nach dem Krieg Experten gebraucht und deswegen abwägen müssen, ob die Belastung erträglich sei. Er stellt heraus, dass „Expertise“ ein Begriff sei, der nicht so klar definiert sei, wie man das vielleicht annehmen könnte, weil etwa das frühe BKA die Mitarbeit in den Terrorschwadronen der sogenannten „Bandenbekämpfung“ in Osteuropa als wichtige „Expertise“ im Kampf gegen das organisierte Verbrechen ansah und in Leuten, deren Karriere 1934 begonnen hatte, „Beamte alten Schlages“ erkannte. Sälter arbeitet überzeugend heraus, dass in vielen Behörden nicht Altnazis trotz, sondern gerade wegen ihrer Belastung eingestellt wurden, weil diese einfach als Expertise umdefiniert wurde. Er stellt als Desiderat für zukünftige Forschung eine Vergleichsstudie zur DDR in den Raum, die wesentlich stärker die Funktionseliten auswechselte. Nur eine solche könnte zeigen, ob das Argument, dass man die Expertise gebraucht habe, zutrifft. Unabhängig davon beschreibt er die Integration dieser Menschen in die Demokratie insofern gelungen, als dass sie nicht aktiv gegen die Demokratie arbeiteten, macht aber deutlich, dass sie auch deswegen so gut funktionierte, weil sie ihre Ideologie und Arbeitsweisen in die BRD hinüberretten konnten.
Eine weitere Fallstudie bietet Manfred Görtemaker in Kapitel 19, „Die aktuelle geschichtspolitische Debatte und die Kommission des Bundesministeriums der Justiz„, anhand des Justizministeriums. Während die Rolle der Juristen im Dritten Reich gut erforscht sei, treffe dies für das Ministerium selbst bisher nicht zu, weswegen die Studien relevant seien. Auch hier zeigt sich deutlich die Rolle der scheinbaren Expertise, die durch den Mythos des „unpolitischen Beamten“ – ein Oxymoron vor dem Herrn.
In die vergleichende Forschung geht Frieder Günther in Kapitel 20, „Zweierlei Kontinuititäten. Die Innenministerien in Bonn und Ost-Berlin nach dem Nationalsozialismus„. Wie der Titel bereits verrät untersucht er einerseits das westdeutsche BMI und andererseits das ostdeutsche MdI. Die Studie ist sehr fruchtbar, weil sie Unterschiede zwischen der Entwicklung in beiden deutschen Staaten exemplarisch herausarbeitet. Das Bundesinnenministerium wies eine hohe Kontinuität zu alten Nazis und ihren Methoden auf, verstand sich aber als demokratisches Ministerium insofern, als dass für das Personal zwar die Demokratie nicht begrüßenswert, aber die beste verfügbare Alternative war. Im Osten dagegen war der Bruch mit den Nazis viel deutlicher, wesentlich weniger Personal wurde übernommen. Man verstand sich anders als das betont „zivile“ BMI als ein „revolutionäres“ Ministerium, mit Uniformen, militärischem Gruß und Traditionspflege der alten Straßenkämpfe.
Ebenfalls die DDR betrachtet Dierk Hoffmann in Kapitel 21, „NS-Schatten in der früheren DDR-Geschichte. Das Beispiel der staatlichen Planungskommission„, in dem er die wirtschaftliche Bürokratie unter die Lupe nimmt. Mehr als in anderen Ministerien war das Wirtschaftsministerium auf Fachleute angewiesen und zog Fachpersonal aus dem Nationalsozialismus heran. Die Wirtschaftspolitik verstand sich auch wesentliche mehr als in der BRD in Kontinuität zu der der 1930er Jahre.
Abschnitt 7, „Medien-Perspektiven„, betrachtet die mediale Aufarbeitung des Holocaust.
Den Anfang macht Olaf Blascke in Kapitel 22, „Endlich genug von Hitler oder bitte noch mehr? Verlage als vergangenheitspolitische Akteure„, in dem er eine quantitative Untersuchung aller Bücher vornimmt, die sich mit dem Nationalsozialismus oder Hitler beschäftigen. Dabei kann er einige „Wellen“ des öffentlichen Interesses identifizieren, die einigermaßen überraschend zeigen, dass etwa Boomphasen von Hitler-Biografien mit den Standardwerken von Joachim (Anfang der 1970er Jahre) und Ian Kershaw (2000) nicht begannen, sondern eher endeten: danach war für eine Weile nichts zu sagen. In letzter Zeit erschienen aber wieder neue Biografien, und Hitler erscheint im Titel von wesentlich mehr Büchern, als sich mit Hitler beschäftigen: er ist ein Verkaufszugpferd, auch weiterhin. Zwar sagen alle immer gerne, dass sie „genug von Hitler“ hätten, aber Angebot und Nachfrage sprechen eine andere Sprache.
Hoch öffentlich sind auch Filme, Dokus und Serien, die Wulf Kansteiner in Kapitel 23, „Mitlaufen, Zuschauen, Mitfühlen. Holocaust-Erinnerung im Fernsehen der Bundesrepublik Deutschland„, untersucht. Er arbeitet heraus, wie wenig die Figur des Mitläufers in solchen Produkten auftaucht, weil wir stattdessen vor allem Bösewichter und Widerstandshelden sehen. Er untersucht zudem mehrere Phasen der Filmproduktion zum Holocaust, die zuerst von Entschuldigungen und Erinnerungen an deutsches Leid, dann von Emotionalisierung, in den 1990er Jahren dann von einer Konzentration auf deutsche Opfer und neuerdings von einem kritischeren Ansatz begleitet seien.
Vertieft mit filmischen Auseinandersetzungen zum Holocaust befasst sich Sonja M. Schultz in Kapitel 24, „Kino und Katharsis? Bilder vom Nationalsozialismus im deutschen Film„. Sie geht in ihrem Beitrag von den Kinobeiträgen der 1950er Jahre, in denen ein großer Boom von Weltkriegskitsch aufkam (man denke an den „Arzt von Stalingrad“) zu zunehmend kritischeren Beiträgen hin zur Serie „Holocaust“ (an der man bei diesen Betrachtungen nie vorbeikommt) zu Guidos Knopp Betroffenheits- und Gutfühlkitsch, den grausigen ÖRR-Produktionen (ich nenne sie immer Artikel+Substantiv-Filme). Sie bezieht auch das internationale Kino ein, sowohl Filme aus dem Ostblock (die im Westen meist wenig rezipiert wurden), aber auch Werke wie „Schindlers Liste“ oder „The Grey Zone“. Insgesamt schafft sie damit einen guten Überblick, der natürlich auf Kosten der Tiefe bei den einzelnen Werken geht, die nur angerissen werden können.
Wesentlich tiefer geht hier Patrick Merziger Kapitel 25, „„Um des Lachens willen sind die Kinos voll.“ Zur Verarbeitung deutscher Vergangenheit in der Filkomödie „Wir Wunderkinder“ (1958)„, der den (mir vorher ehrlich gesagt unbekannten) Film „Wir Wunderkinder“ von 1958 bespricht. Die Verfilmung einer (wesentlich problematischeren) Buchvorlage erlangte zur damaligen Zeit viel Lob und auch großen internationalen Erfolg, überraschenderweise in Ost wie West. Das liegt wohl auch an der Ambivalenz des Films, der sich einer eindeutigen Interpretation verschließt und sowohl sehr selbstkritisch als auch selbstbestätigend gelesen werden kann. Für meinen Geschmack war der Beitrag Merzigers schon fast zu detailliert, aber das sagt natürlich weniger über seine Qualität als meine Präferenzen aus.
Abschnitt 8, „Raubkunst und Restitution„, befasst sich mit dem Umgang der Restitution geraubter Kunstgüter.
Hierfür unternimmt Johannes Gramlich in Kapitel 26, „NS-Raubkunst und die Herausforderung der Restitution„, vor allem eine fachliche Einordnung und stellt fest, was unter dem Begriff eigentlich verstanden wird. Konkret wendet er sich gegen den Begriff der „Raubkunst“, weil dieser die vielen Dimensionen des Problems mehr verschleiere als erhelle, da von direktem Raub zu forcierten Ankäufen bis zu scheinlegalen Geschäften ein großes Spektrum geboten wird, das entsprechend auch die Restitution deutlich erschwert.