Jürgen Osterhammel/Jan C. Hansen – Dekolonisation: Das Ende der Imperien
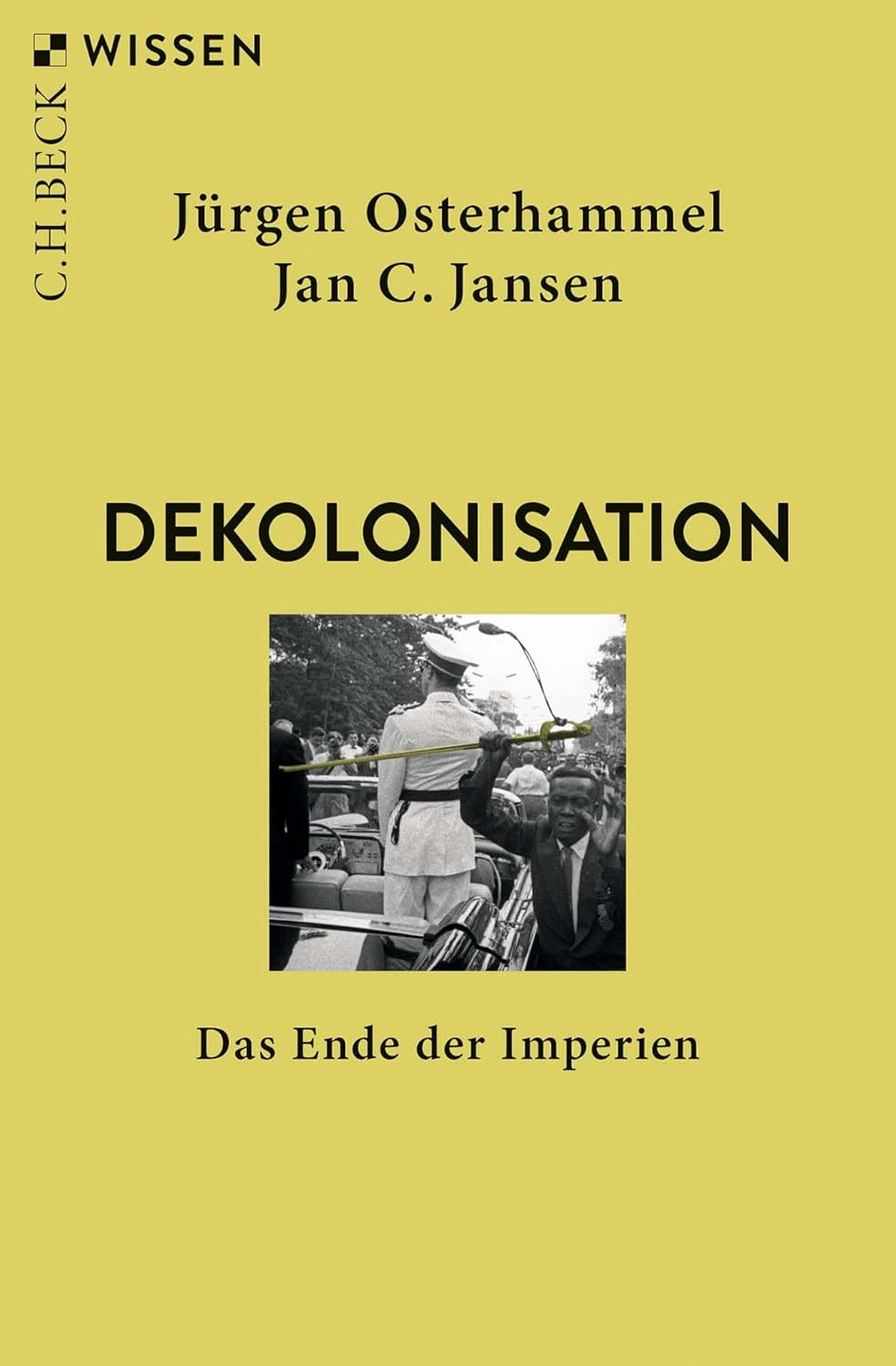 Das Ende der Imperien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einerseits ein Prozess, der in der europäischen Geschichtsschreibung vorrangig als ein Kapitel der jeweiligen europäischen Nationalgeschichten erzählt wird, allzu oft mit einer theleologischen und nostalgisch verklärten Note. Die Größe dieses Umbruchs geht darüber oft verloren, auch, weil die betroffenen Regionen üblicherweise als „3. Welt“ subsumiert und damit als nicht sonderlich bedeutend kategorisiert werden. Dabei ist der Prozess der Dekolonisation einer, der einen fundamentalen Wandel der Weltordnung nahelegt. Bedenkt man, dass die UNO von kaum 50 Staaten gegründet wurde, von denen gerade drei aus Asien und zwei aus Afrika waren, und heute 193 Staaten Mitglied sind, erkennt man die Bedeutung für zwei Kontinente, auf denen die Hälfte der Weltbevölkerung lebt. In den letzten Jahren ist diese Epoche vermehrt in die Aufmerksamkeit von Historiker*innen geraten und seit Neuestem auch in den Geschichte-Bildungsplänen fest verankert. Sinnvoll also, ein Grundlagenwerk zu kennen und sich dazu der bekannten Reihe von C. H. Beck zu bedienen, die gleichzeitig den Vorteil hat, sehr übersichtlich zu sein.
Das Ende der Imperien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist einerseits ein Prozess, der in der europäischen Geschichtsschreibung vorrangig als ein Kapitel der jeweiligen europäischen Nationalgeschichten erzählt wird, allzu oft mit einer theleologischen und nostalgisch verklärten Note. Die Größe dieses Umbruchs geht darüber oft verloren, auch, weil die betroffenen Regionen üblicherweise als „3. Welt“ subsumiert und damit als nicht sonderlich bedeutend kategorisiert werden. Dabei ist der Prozess der Dekolonisation einer, der einen fundamentalen Wandel der Weltordnung nahelegt. Bedenkt man, dass die UNO von kaum 50 Staaten gegründet wurde, von denen gerade drei aus Asien und zwei aus Afrika waren, und heute 193 Staaten Mitglied sind, erkennt man die Bedeutung für zwei Kontinente, auf denen die Hälfte der Weltbevölkerung lebt. In den letzten Jahren ist diese Epoche vermehrt in die Aufmerksamkeit von Historiker*innen geraten und seit Neuestem auch in den Geschichte-Bildungsplänen fest verankert. Sinnvoll also, ein Grundlagenwerk zu kennen und sich dazu der bekannten Reihe von C. H. Beck zu bedienen, die gleichzeitig den Vorteil hat, sehr übersichtlich zu sein.
Osterhammel und Hansen beginnen ihr Werk in Abschnitt 1, „Dekolonisation als Moment und Prozess„, mit einem ersten Kapitel „Souveränität und Normenwandel„. Darin stellen sie fest, dass die Souveränität der früheren Kolonien nicht nur einen machtpolitischen Bruch darstellt, sondern auch einen Normenwandel: die Idee der Fremdherrschaft über ein anderes Volk erlebte eine rapide Delegitimierung, die bereits ab 1960 (als diese in der Charta der UNO kodifiziert und damit völkerrechtlich verbindlich wurde) zu einer Welle von Dekolonisierungen führte, die bis auf einige kleine Reste bis 1974 weitgehend abgeschlossen war. Im zweiten Kapitel, „Zeiten und Räume„, erkennen die Autoren die sinnstiftende Bedeutung von Unabhängigkeitstagen für die neuen Nationen an. Sie halten es für bedeutsam, dass anders als zu jedem anderen historischen Zeitpunkt die niedergehenden Imperien nicht durch neue ersetzt wurden: der erwähnte Normenwandel machte dies unmöglich.
Die zur Forschung notwendige Theorie stellt Kapitel 3, „Analyseperspektiven und Erklärmodelle„, bereit. Osterhammel und Hansen unterscheiden zwischen imperialen, lokalen und internationalen Zugängen, die jeweils ihre eigenen Blickwinkel auf die Dekolonisation zulassen und wertvoll sind, und stellen mit den Merkmalen der späten Kolonisationszeit, den äußeren Bedingungen, dem Verlauf der Dekolonisierung und den kurz- und mittelfristigen Folgen einen strukturellen Rahmen. Dazu kommen verschiedene Unabhängigkeitsprozessmodelle: Machtübertragung, Selbstbefreiung, Neokolonialismus, Entlastungsmodell, Weltpolitik. Diese bestünden seit den 1980er Jahren im Wesentlichen unverändert. Neue Erkenntnisse seien vor allem, dass weiterhin eine Staatenhierarchie bestehe, dass der Verlust der Kolonien für die Imperien keine negativen Konsequenzen hatte und dass es keine direkte Kausalität zwischen kolonialer Lage, Dekolonisationsprozess und heutiger Situation gebe.
Abschnitt 2, „Nationalismus, Spätkolonialismus, Weltkriege„, stellt sich der Frage, ob das Ende des Ersten Weltkriegs gleichzeitig als Beginn der Dekolonisierung gesehen werden könne. Die Antwort ist ambivalent: einerseits ja, weil viele Argumentationen (Reformversprechen, Selbstbestimmungsrecht) und Konflikte, die später relevant werden würden, offen ausbrachen, andererseits nein, weil der Völkerbund sich nie so wie die UNO antikolonial entwickelte und die imperiale Herrschaftspraxis erhalten blieb. Das vierte Kapitel, „Antikolonialismus und Nationalismus„, stellt einleitend fest, dass antikoloniale Bewegungen vielfältig und von den Bedingungen vor Ort geprägt waren. Die Verbindung von Antikolonialismus und Nationalismus sei dabei keine Selbstverständlichkeit; vielmehr seien auch viele andere Modelle diskutiert worden. Die antikolonialen Bewegungen seien zudem häufig durch einen Gegensatz von Modernisten (häufig sozialistisch geprägt) und Traditionalisten (häufig religiös geprägt) gekennzeichnet gewesen. Ethnische und Stadt-Land-Konflikte prägten sie zudem ebenfalls. Zudem waren die Bewegungen in ihren jeweiligen Heimaten keineswegs unumstritten. Zuletzt gab es zwar keine internationale Bewegung, aber die Ideologien befanden sich in einem intellektuellen Austausch.
Kapitel 5, „Spätkolonialismus und Entwicklung„, betrachtet die Entwicklung der Kolonien in der Zwischenkriegs- und Nachkriegszeit. Hier machen die Autoren vor allem eine Bestrebung zur Effizienzsteigerung und Verwissenschaftlichung aus, die auch politische Reformen einschloss. Zwar bestand hier nie vollständige Gleichberechtigung, aber immer größere Schichten der Kolonisierten wurden einbezogen. Dies sei aber keinesfalls ein Prozess der Dekolonisierung gewesen; vielmehr sei es um Herrschaftssicherung gegangen. Im folgenden sechsten Kapitel, „Neue Imperialismen und Zweiter Weltkrieg„, charakterisiert die totalitären Regime Japans, Italiens und Deutschlands als imperialistisch, aber wesentlich grausamer und ausbeuterischer als die „klassischen“ imperialen Herrschaften. Die präzedenzlose Mobilisierung der Kolonien durch die Alliierten führte zwar zu mehr Mitbestimmung, aber die blutige Unterdrückung der Nationalbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg konnte keinen Zweifel daran lassen, dass Unabhängigkeit nicht in den Karten stand.
Der dritte Abschnitt, „Wege zur Souveränität„, stellt eingangs fest, dass es keine klare Struktur der Dekolonisierung gibt: während Asien vor allem zu Ende des Zweiten Weltkriegs dekolonisiert wurde, sind in Afrika regional stark unterschiedliche Verläufe auszumachen. Kapitel 7, „Asien„, beginnt dann mit dem bevölkerungsreichsten Kontinent. Die Dekolonisierung Indiens sehen die Autoren als Musterbeispiel eines gescheiterten transfer of power, der durch musterhafte innere Konflikte der indischen Nationalbewegung und Fehler der Kolonialmacht keine Chance hatte. Demgegenüber stellen sie Sri Lanka als gelungenes Beispiel. Die amerikanische Machtübergabe an die Philippinen erfolgte aus einer Position der Stärke, doch das Ausbleiben von Landreformen hielt das Land in der Armutsfalle (das erinnert mich an Joe Studwells „How Asia works„, hier besprochen). Anders verlief das „abschreckende Beispiel“ Birma, das die Autoren auch auf die brutale Herrschaftspraxis in der Kolonie zurückführen. Indonesien dagegen zeige im Entstehen einer eigenen Nationalbewegung, die das Machtvakuum des niederländischen Zusammenbruchs 1940 füllte, eine eigene Art der Machtübernahme. Demgegenüber sei in Vietnam, anders als Indonesien, eine Teilung vorgenommen worden, obwohl in beiden Ländern der Nationalismus erst spät eine eigene Identität schuf. Ethnisch besonders divers war Malaya, in dem die unterdrückten Chinesen einen kommunistischen Guerillakrieg gegen die Briten führten, den diese brutal niederschlugen und die ehemalige Kolonie so im Empire halten konnten.
Kapitel 8, „Naher Osten und Nordafrika„, beginnt mit einem Blick auf Großbritannien. Dieses versuchte, in Ägypten seine Herrschaft durch eine Scheinunabhängigkeit zu bewahren. Gleichzeitig wurde die Kolonie Irak einigermaßen friedlich unabhängig gemacht, während Frankreich in Syrien und Libanon mit Gewalt an der Macht zu bleiben versuchte. Anders war die Lage in Palästina, wo die britische Politik sich im örtlichen Bürgerkrieg pulverisierte. Der Versuch Frankreichs und Großbritanniens, ihren Einfluss in der Region militärisch in der Suezkrise durchzusetzen, scheiterte kläglich. Sie sei aber kein Signal zur Dekolonisation, sondern vor allem ein regionales Phänomen, das zum Machtausbau der örtlichen Nationen und einer engeren Anbindung an die USA führte. Das französische und spanische Nordafrika indes waren eng miteinander verknüpft, wenngleich die Prozesse sich in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich entwickelten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf dem gewalttätigen Dekolonisierungsprozess in Algerien.
Kapitel 9, „Südliches Afrika„, zeigt, wie die Vorstellung eines Erhalts der afrikanischen Kolonialreiche in den 1950er Jahren der Erkenntnis der Unaufhaltbarkeit der Dekolonisierung Platz machte. Die vorherige Verschleppung sorgte für überhastete Machtwechsel. Anhand des Beispiels der Goldküste (Ghana) zeigen die Autoren, wie Versuche der Liberalisierung von einer dekoloniserenden Eigendynamik überrollt wurden und zu einer Welle von Unabhängigkeiten Anfang der 1960er Jahre führten. Anhand der französischen Kolonien werden Gegensätze der jeweiligen lokalen Eliten und der den Befreiungskampf oftmals tragenden benachteiligten Schichten gezeigt. Auch für Frankreich scheiterte der Versuch, die Kolonien in einem größeren politischen Verband zu halten. Ein besonders negatives Beispiel von aus früherer Gewaltherrschaft resultierendem Chaos zeigen sie Autoren mit der Geschichte des Kongo. Auch innere Konflikte werden beleuchtet, etwa in Kenia oder in Südafrika, wo die britische Kolonialmacht sie sich einmal zunutze machte und im anderen Falle nicht in der Lage war, eine Befriedung herbeizuführen, die zu einer Sezessionsbewegung führte.
Das zehnte Kapitel, „Letzte Dekolonisationen„, schließlich wendet sich dem Ende des portugiesischen und spanischen Kolonialreichs in den 1970er Jahren zu, das diese vor allem „aus nationalistischen Gründen“ behalten hätten. Neben Südafrika, das lange mit Repression in Hand der weißen Siedler*innen blieb, befasst sich das Kapitel mit einer Reihe kleinerer Kolonien etwa in der Karibik oder Asien, die in dieser Spätphase unabhängig wurden.
Abschnitt 4, „Wirtschaft„, beginnt mit der Feststellung, dass der Kolonialismus in den Kolonien stets eine ökonomische Revolution bedeutet hatte, die die neuen Nationalstaaten nicht rückgängig zu machen gedachten. Das elfte Kapitel, „Privatinteressen„, verwirft sowohl die Idee, dass die Kolonien des 19. und 20. Jahrhunderts aus primär wirtschaftlichen Interessen erworben worden wären als auch die Vorstellung, dass private Geschäftsinteressen staatliches Handeln bestimmt hätten. Zwar waren die wenigsten Kolonien kostendeckend oder gar gewinnbringend, aber es habe immer irgendwelche Privatleute gegeben, die Gewinne in ihnen gemacht hätten. Eine Besonderheit waren die wenigen Siedlerkolonien; die Unmöglichkeit, den auf rassistischen Hierarchien beruhenden Landbesitz zu kapitalisieren, machte sie zu gegenüber Machttransfers besonders resistenten Einflussgruppen. Zwar versuchten die in den Kolonien agierenden Unternehmen, die Unabhängigkeitsbewegungen zu behindern, konnten aber selten die Politik ihrer Heimatländer bestimmen. Generell erklären die Autoren, dass die Macht der Koloniallobbys in dem Maße schwand, wie es ihnen nicht mehr gelang, ihre Interessen als deckungsgleich mit denen der Nation zu präsentieren.
Das zwölfte Kapitel, „Strategie und Übergänge„, zeigt, dass gleichwohl die Unabhängigkeit selten eine Kappung wirtschaftlicher Verflechtungen mit sich brachte. Am sichtbarsten war dies bei den Staatsschulden, die den neuen Nationen aufgebürdet wurden, und bei der Verzögerung von Verstaatlichungen und Enteignungen der Kolonialunternehmen. Nur Großbritannien habe eine klare Strategie verfolgt, die Schaffung der Sterling-Zone, die gleichwohl mit der zunehmenden Bedeutung des durch die USA forcierten freien Handels und dem Machtverlust Großbritanniens an Relevanz verlor. Zudem weisen die Autoren darauf hin, dass oftmals einheimische Eliten gegen den Kolonialismus waren, weil er der Modernisierung der eigenen Volkswirtschaften im Weg stand. Kapitel 13, „Entwicklung und Politik„, weist noch auf die grundsätzliche Entwicklungslinie hin, dass die Konzerne ihr Interesse an den Kolonien verloren, als diese durch eigenständige Politik die vorherige Sicherheit zerstörten, und dass die Verlagerung des Welthandels auf die USA, Westeuropa und Japan die ehemaligen Kolonien wirtschaftlich gegenüber der Kolonialzeit marginalisierte.
Abschnitt 5, „Weltpolitik„, beginnt direkt im vierzehnten Kapitel, „Ost/West-Nord/Süd„, behandelt die „Dritte Welt“ als sich von der Blockbildung unabhängig zu machen versuchende Selbstverortung der ehemaligen Kolonien. Den Versuch der Supermächte, die „Dritte Welt“ in ihre Einflusssphären zu zwingen, bestimmte die Außenpolitik in großem Ausmaß. Der Nord-Süd-Konflikt dagegen bezieht sich stärker auf das wirtschaftliche Ungleichgewicht der beiden Hemisphären. Auch hier muss natürlich vor Vereinfachungen gewarnt sein; zahlreiche Ausnahmen bestätigen die Regel. Kapitel 15, „Kalter Krieg: von Korea bis Angola„, zeigt auf, wie die Vorstellung der USA, die Kolonialmächte würden nach 1945 ihre Kontrolle wieder herstellen und dann die Macht à la den Philippinen abgeben, in die Irre ging. Die Nationalbewegungen waren wesentlich stärker und eigenwilliger als gedacht, und in der Sowjetunion entstand ein mächtiger Gegenpart.
Erst der Koreakrieg änderte die amerikanische Sicht zu containment und damit auch wie in Vietnam zu einer Unterstützung der Kolonialmächte. Diese wandelten sich durch den US-Einfluss allerdings deutlich, wie das Bonmot vom „more than British, less than an Empire“ zeigt. Die Verhinderung einer kommunistischen Regierung nach der Unabhängigkeit wurde zur zentralen Beschäftigung der Außenpolitik des Westens in der Dritten Welt. Umgekehrt verstärkte die UdSSR nach der ersten Welle der Dekolonisierungen ihren eigenen Einfluss, so dass südlich der Sahara stark mit Sowjetwaffen unterstützte „kommunistische“ Staaten entstanden. Kapitel 16, „Elemente einer neuen Ordnung„, beginnt mit der Feststellung, dass die Dekolonisierung bis 1990 keine Änderung der globalen Mächteverhältnisse hervorbrachte, trotz unermesslichen Leids in den Konflikten der Region. Die Autoren verweisen zudem auf die normativen Probleme, die diese Kämpfe oft mit sich brachten – Verteidigung „westlicher Werte“, die offensichtlich im Gegensatz zur gelebten Praxis standen – und die Notwendigkeit, die Deutungshoheit zu gewinnen.
Abschnitt 6, „Ideen und Programme„, schließt nahtlos an diese Erkenntnis an und erklärt, dass die westlichen Intellektuellen in ihrer Beschäftigung und ihrem Engagement gegen (und seltener für) den Kolonialismus ein „schillerndes Erbe“ hinterlassen hätten. Kapitel 17, „Themen und Positionen„, versucht sich an der Herausarbeitung von Themenfeldern dekoloniserten Denkens. Dazu gehört die Naturalisierung der Dekolonisierung, sie also als Normalfall zu akzeptieren, was einen bedeutenden historischen Umbruch darstelle; die Idee von „Spielarten der Souveränität“, weil der Nationalstaat nicht das einzig denkbare Konzept wurde, sondern dies erst durch mehrere Experimente wie Pan-Staaten wurde; die Idee, dass der Kolonialismus überhaupt jetzt erst als historisches Konzept greifbar und erforschbar wurde; und zuletzt das für etwa drei Jahre bedeutende Konzept der „Dritten Welt“ als Sammelbegriff. Kapitel 18, „Denken für ein „postkoloniales“ Zeitalter?„, betrachtet dann die Entstehung dieses Phänomens, das die Autoren aber als rein akademisches betrachten; erst in jüngster Zeit gewinne das Konzept an politischer Bedeutung.
Abschnitt 7, „Rückwirkungen und Erinnerungen„, stellt fest, dass das Ende der Imperien auch die Bewegungsfreiheit innerhalb der ehemaligen Imperien einschränkte und so Wirkung auf die Nationalstaatsbildung der Metropolen hatte. Kapitel 19, „Rückwirkungen„, erklärt apodiktisch, dass die Rückwirkungen der Dekolonisierung auf die Metropolen sehr spezifisch sind und im Einzelfall untersucht werden müssen. Wo Großbritannien mit einem Allparteienkonsens das Kolonialreich abwickelte, führte die Dekolonisierung in Frankreich und Portugal zum Sturz des politischen Systems. Wirtschaftlich dagegen habe die Dekolonisierung auf die Metropolen keine relevanten Auswirkungen gehabt. Migrationswellen aufgrund von Dekolonisierung veränderten allerdings die Gesellschaften. Die kulturellen Rückwirkungen seien schwieriger zu bestimmen. Kapitel 20, „Erinnerungen„, postuliert, dass die Erinnerung in den Kolonien vor allem an der Unabhängigkeit und Nationswerdung hing und erst später die Reste der Metropol-Monumente beseitigt wurden. In den Metropolen selbst wurde die Erinnerung vielfach verdrängt, ein Prozess, der erst seit den 1990er Jahren einem differenzierteren Blick Platz macht. Immer öfter werden erinnerungspolitische Konflikte wie zwischen Korea und Japan auch Gegenstand der Diplomatie.
–
In der Tradition der Reihe C. H. Beck Wissen ist auch dieser Band einer, der durch seine geringe Größe (126 Seiten im A6-Format) auffällt und in einem Nachmittag bequem lesbar ist. Gleichzeitig richten sich die Werke durchaus eher an einschlägig Interessierte oder Studierende; das Sprachniveau wie die Informationsdichte sind hoch. Gleichzeitig werden Grundkenntnisse vorausgesetzt; dass etwa der Kongo eine belgische Kolonie war und dass dort Gräuel stattfanden wird nicht mehr erwähnt, genauso wenig wie die Geschichte Indiens vor 1947 große Erwähnung findet. Dies kann durchaus ein Hindernis darstellen. Insgesamt versteht sich der Band aber als Überblickswerk und enthält deswegen auch wenig große Thesen.
Ich habe deswegen nur zwei Bemerkungen dazu. Einerseits mag es zwar sein, dass das Konzept der „Dritten Welt“ nur für drei Jahrzehnte in der akademischen Welt Relevanz hatte; politisch und gesellschaftlich aber hat es wesentlich größere Beharrungskräfte. Ich würde argumentieren, dass bis heute das Denken in den Kategorien der „Dritten Welt“, die alle Länder in einen Topf wirft, weit verbreitet ist, was angesichts des Aufstiegs und Bedeutungsgewinns vieler dieser Nationen in einer multipolaren Welt ein Problem darstellt. Gerade hier kann das Denken in den hier vorgestellten Linien und die postkoloniale Theorie viel Aufbrechensarbeit leisten. Das wäre auch der zweite Punkt: der von den Autoren attestierte Bedeutungsgewinn des Postkolonialismus als Idee kann als hellsichtige Prognose abgeheftet werden; die Explosion des Begriffs 2024/25 und die darum losgetretenden Debatten attestieren sowohl die neue Bedeutung und Aufmerksamkeit als auch das beklagenswert niedrige fachliche Niveau der gesamten Debatte.




Danke auch wieder für diese Rezension. Guter Überblick
Am interessantesten finde ich aktuell den Aspekt der
“ Explosion des Begriffs 2024/25 und die darum losgetretenden Debatten“
Kann man festmachen, wo und wann? Warum gerade an US-Unis?
Das ist relativ einfach: Israel wird von jungen Antisemiten vorwiegend aus der arabischen Welt und aus den westlichen Staaten unter „Kolonisten“ abgelegt. Dementsprechend ist JEDE Form von „Widerstand“ gegen Israel solange angemessen, bis der jüdische Staat von der Landkarte verschwindet, sprich, seine Bevölkerung ermordet wurde. Deswegen die „Explosion des Begriffes“ vorwiegend oder ausschliesslich an britischen und US-Universitäten bzw. deren Umfeld.
Gruss,
Thorsten Haupts
Die Frage ist ja, WARUM dieses Denkmuster gewählt wird.
Schmalgespurte Dekolonisierungs- und „Critical Whiteness“-Theorie. Entspricht heute dem, was in den siebzigern und achtzigern Schmalspur-Marxismus war. Ursprung in beiden Fällen derselbe – populäre Theorien in Geistes- und Sozialwissenschaften an den Unis, vermittelt über offizielle Lehrinhalte. Für eine weitergehende „Warum“-(also Motiv-) Suche gibt es keine wissenschaftlich belastbaren Antworten, ausser der schlichten Feststellung, dass wir uns mit Studenten/Einwanderern aus dem arabischen Raum natürlich auch deren gesammelte Vorurteile eingehandelt haben.
Der Begriff „postcolonialism“ ist nicht 24/25 explodiert sondern im Gegenteil eher rückläufig und das meiste Interesse kam nicht aus USA oder Westeuropa sondern aus früheren Kolonien:
https://trends.google.de/trends/explore?date=all&q=Postcolonialism&hl=de
Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, das ist einfach eine intellektuelle Mode, wie sie immer wieder vorkommt.
144 Seiten über so viele unterschiedliche Regionen und Kulturen kann natürlich nur einen Blick aus dem Flugzeug liefern, aber trotzdem interessant.
Mir fällt immer wieder auf, dass Leute rinks wie lechts ihr Überblickswissen aus der europäischen Geschichte oder soziologische Strukturen auf andere Regionen anwenden. Unter Postkolonialismus muss man ja nicht verstehen, dass ein paar Hansel die Statue eines ehemaligen Sklavenhändlers in einem englischen Hafenbecken versenken. Hab jetzt zufällig ein Interview vom Schweizer Fernsehen mit Adom Getachew entdeckt, deren viel beachtetes Werk zu Postkolonialismus gerade auf Deutsch übersetzt wurde.
https://www.amazon.de/Welt-nach-Imperien-postkolonialen-Selbstbestimmung-ebook/dp/B09WYWSHRM?ref_=ast_author_dp
Man kann sich durchaus über die afrikanische Unabhängigkeit beschäftigen, ohne dass man die gesamte europäische Geschichte als einen einzigen Unterdrückungs-Betrug sieht. Die Leute verlieren einfach einen tragischen Blick auf Geschichte.
Keine Macht den Doofen.
Hier Link auf die angekündigte Sendung aus dem Schweizer Fernsehen.
https://www.youtube.com/watch?v=OhzEZuFyq-s
Es ist ein wenig schade, wie sehr sich das Buch auf die Phase zwischen 1946 und 1975 beschränkt. Dadurch sind einige Punkte seltsam unbeleuchtet:
i) Die Dekolonisierung der Amerikas zwischen 1776 und 1830
ii) Dass der Prozess noch andauert: Hongkong und Macao wurden erst in den späten90ern übergeben. Osttimor war (formal) bis 2002 portugiesisch.
iii) Und es immer noch Kolonien (die UN listet 17 unselbständige Überseegebiete auf) sowie verschiedene Überseegebiete (z.B. Reunion oder Guadeloupe) als Teil des Staatsgebiets gibt.
iv) Sowie eigentlich souveräne Staaten, die aber protokollarisch einen europäischen Feudalherrn als Staatsoberhaupt haben. Bemerkenswert: der Begriff Commonwealth kommt in deiner Besprechung nicht einmal vor.
Irgendwie muss man ja das Thema eingrenzen. Im Grunde gehoert ja auch die Rueckdraengung der amerikanischen indigenen Voelker in den USA, Kanada, suedlichem Chile/Argentinien nach 1870, Aborigines in Australien. Der arabische Imperialismus in Nordafrika (Stichwort Berber) und Spanien ab etwa 800 n.Chr. Das Osmanische Reich. Die Russische Expansion in Nordasien, dem Kaukasus, Polen, Baltikum, Finland, etc. Der Deutsche Ritterorden im Baltikum. Der Expansionismus von Inkas und Azteken. Die Verdraengung der Indigenen Staemme oestlich der Anden durch die Mapuche, der Imperialismus der Republik Chile auf der Osterinsel in der 2. Hlft. des 19. Jhts. man findet da kein Ende. Die Reduktion auf den Zeitraum 1945 bis 1975 ist absolut notwendig.
Klar, aber irgendwo musst nen Punkt machen.
Zu III)
Ob die überhaupt noch unabhängig werden wollen, weiss ich nicht. Kolonien impliziert aber (aktuelle) Unfreiwilligkeit. Haben Sie dafür Indizien?
Zu IV)
Die Souveranität der Staaten im Commonwealth steht völlig ausser Frage und die Wahl ihres protokollarischen Staatsoberhauptes ist seit langer Zeit freiwillig. Sowas gehört also nicht in ein Buch über De-Kolonialisierung.
Gruss,
Thorsten Haupts