Matthias Waechter – Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert
 C.H. Becks Reihe zur Geschichte des 20. Jahrhunderts hat mit Ulrich Herberts Mammutwerk zur deutschen Geschichte (hier rezensiert) einen ebenso prominenten wie lesenswerten Blickfang. Aber die Grundstruktur einer Mischung aus Quer- und Längsschnitten durch die Geschichte, die der Reihe zugrunde liegt, ist grundsätzlich ebenso erhellend wie dem Lesefluss zugänglich, so dass Matthias Waechters Eintrag in die Reihe für die Geschichte Frankreichs für mich eine Art Lackmustest des Serienkonzepts darstellt: da ich in der Geschichte der Republik nicht so sehr bewandert bin, kann ich auf wesentlich weniger Vorwissen zurückgreifen als bei Herberts Mammutwerk. Ob Waechter es für mich trotzdem verständlich machen kann? Immerhin hat er nur ein starkes Drittel des Umfangs von Herbert, aber nichtsdestotrotz ist die Fülle an Informationen, Analysen und Einordnungen und ihre große Dichte durchaus eine Herausforderung. Ich habe mich mit großer Freude an sie gemacht.
C.H. Becks Reihe zur Geschichte des 20. Jahrhunderts hat mit Ulrich Herberts Mammutwerk zur deutschen Geschichte (hier rezensiert) einen ebenso prominenten wie lesenswerten Blickfang. Aber die Grundstruktur einer Mischung aus Quer- und Längsschnitten durch die Geschichte, die der Reihe zugrunde liegt, ist grundsätzlich ebenso erhellend wie dem Lesefluss zugänglich, so dass Matthias Waechters Eintrag in die Reihe für die Geschichte Frankreichs für mich eine Art Lackmustest des Serienkonzepts darstellt: da ich in der Geschichte der Republik nicht so sehr bewandert bin, kann ich auf wesentlich weniger Vorwissen zurückgreifen als bei Herberts Mammutwerk. Ob Waechter es für mich trotzdem verständlich machen kann? Immerhin hat er nur ein starkes Drittel des Umfangs von Herbert, aber nichtsdestotrotz ist die Fülle an Informationen, Analysen und Einordnungen und ihre große Dichte durchaus eine Herausforderung. Ich habe mich mit großer Freude an sie gemacht.
Der erste Teil, „Republik der Widersprüche„, behandelt die Zeit zwischen 1870 und 1914. Interessant ist an der Überschrift für mich bereits, dass ähnlich der Geschichte des Kaiserreichs die Widersprüchlichkeit der Zeit zwischen Moderne und Beharrung betont wird, die Deutschland und Frankreich trotz aller Unterschiede zu teilen scheinen.
Im ersten Kapitel, „Die Erschaffung einer Nation„, befasst sich Waechter mit dem Paradox, dass die in der Kriegsniederlage von 1870 geborene Dritte Republik zwar eine Traditionslinie zu den Idealen der Französischen Revolution in Anspruch nahm, die Realität dem aber gar nicht entsprach. Weder war die Gleichberechtigung aller Bürger gegeben, noch war die kolportierte Einheit der Nation erreicht. Vielmehr war Frankreich in verschiedene Regionen zergliedert, die teilweise so stark unterschiedliche Dialekte hatten, dass von verschiedenen Sprachen gesprochen werden musste.
Entsprechend gingen die republikanischen Reformer, die in den 1880er Jahren gegenüber den republikfeindlichen Konservativen die Mehrheit errangen, ans Werk, diese nationale Einheit und damit die Nation schlechthin überhaupt erst zu schaffen. Sie verordneten Verwaltungsreformen, trieben die Trennung von Staat und Kirche voran (die zu einem jahrzehntelangen kalten Bürgerkrieg führte, ehe sie zu Beginn des 20. Jahrhunderts weitgehend im Sinne der Republik befriedet wurde) und schufen ein Schulsystem, das die „französische“ Sprache und Kultur verbindlich in alle Winkel des Hexagons brachte. Der Prozess war lang und von Rückschlägen geprägt, aber das Endziel war relativ klar. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs war Frankreich ein wesentlich anderes Land als 1870 und tatsächlich wesentlich geeinter und „nationaler“. Auch hier liegt in meinen Augen eine klare Parallele zur deutschen Geschichte.
Das zweite Kapitel, „Ein republikanisches Imperium?„, wendet sich dem französischen Kolonialreich zu. Von Beginn an lag in den republikanischen Idealen ein Widerspruch zu der Idee, ein Imperium zu erwerben (ein solches war mit Napoleon III. ja gerade erst zu Ende gegangen!). Dennoch trieb die Republik den Erwerb von Kolonien voran und gliederte sie ideologisch in das republikanische Projekt ein: in der Selbstwahrnehmung brachte Frankreich Kultur und Entwicklung und verfolgte das Fernziel, die Einwohner*innen der Kolonien zu französischen Citoyens zu erziehen, die irgendwann einmal so weit sein sollten, auch Franzosen zu sein. Wie in Frankreich selbst wurde dabei auf lokale Eigenheiten keinerlei Rücksicht genommen; das französische Einheitsprojekt sollte alles andere beseitigen.
Kapitel 3, „Eine „blockierte Gesellschaft“?„, wirft unter der Fragestellung, ob das Modernisierungsprojekt nicht von gesellschaftlichen Unterschieden und Spannungen blockiert worden war, einen Blick auf die soziologische Zusammensetzung Frankreichs jener Tage. So war das Land bei allen politischen Egalitätsvorstellungen von sozialen Ungleichheiten geprägt, die den Vergleich mit Nachbarn im schlechten Sinne nicht zu schämen brauchten. Eine schmale Führungsschicht der Reichen und Mächtigen thronte über einer weitgehend armen Masse. Anders als etwa im Kaiserreich aber waren große Teile der Bevölkerung als kleine und mittlere Bauern tätig; Frankreich war gewissermaßen eine Bauernrepublik. Entsprechend verfügte das Land auch über keine Arbeiterschicht in dem Sinne; die Industrie war auf wenige Regionen konzentriert und selbst dort eher mittelständisch organisiert. Eine Arbeiterbewegung konnte so nicht entstehen.
Das größte Thema der Zeit aber war die Bevölkerungsentwicklung – beziehungsweise ihr Stagnieren. Anders als im vitalen Nachbarland Deutschland entwickelte sich die Bevölkerung nicht voran, der demographische Abstand, mit Sorge betrachtet und als elementares Sicherheitsrisiko gesehen, wuchs immer mehr. Der Arbeitskräftebedarf war nur durch Einwanderung zu decken, die wiederum von den alteingesessenen Franzosen mit großem Misstrauen beachtet wurde; die Eingewanderten waren Bürger maximal zweiter Klasse und in besonderem Maße von Ausgrenzung und wirtschaftlichen Problemen betroffen.
Das vierte Kapitel, „Frankreich um 1900„, bietet den ersten Querschnitt des Bandes. Besondere Aufmerksamkeit erfährt dabei die Dreyfus-Affäre, die das Land für fast zwei Jahrzehnte beschäftigte und zum Blitzableiter des großen Rechts-Links-Gegensatzes der Republik wurde: der Antisemitismus und Antirepublikanismus der Rechten kaprizierte sich auf das Festhalten an der (längst widerlegten) Schuld des Hauptmanns und dem Schutz der „Ehre der Armee“, während die republikanischen „Radikalen“ eher versuchten, den Hauptmann zu rehabilitieren und im gleichen Atemzug ihre Gegner zu diskreditieren. Antisemitismus und Nationalismus erlebten um 1900 ihre unheilige Blüte und konzentrierten sich auf die Affäre (und natürlich den damit verwobenen Streit um den Laizismus).
Ein anderer Schwerpunkt von Waechters Betrachtung ist die Rolle Paris‘, das als Hauptstadt Frankreichs einerseits ein riesiges wirtschaftliches Bevölkerungszentrum war, als Heimat von Kultur und Wissenschaft aber auch eine bis heute bestehende Sonderrolle innerhalb der französischen Gesellschaft einnahm, wie sie etwa Berlin nie für sich in Anspruch nehmen konnte. Paris und Frankreich waren nicht eins, auch wenn man das in Paris naturgemäß anders sah, eine Spannung, die sich wie ein Roter Faden durch die französische Geschichte zieht und bereits in der Revolution 1789 und dem Aufstand der Kommune 1870/71 ihre Vorläufer hat.
Der zweite Teil, „Gewonnener Krieg, verlorener Frieden„, behandelt die Zeit zwischen 1914 und 1940. Der Erste Weltkrieg ist natürlich ein einschneidender Punkt in der französischen Geschichte, der nur vordergründig nicht einen Bruch wie in Deutschland darstellt.
Eben dieser wird in Kapitel 5, „Der Große Krieg„, behandelt. Waechter geht es dabei nicht um eine umfassende Schilderung des Kriegsverlaufs, sondern vor allem um seine Genese und Entwicklung. In der Genese geht es vor allem die Entwicklung des französischen Allianzsystems, das sich in den Jahren vor dem Krieg entscheidend von einem Defensivbündnis hin zu einer kollektiven Garantie verwandelte, die auch kriegerische Entwicklungen auf dem Balkan einschloss und damit den europäischen Krieg ebenso garantieren half wie der spätere deutsche Blankoscheck. Die eigentliche Kriegsentwicklung legt Wert auf die „Union Sacrée„, die französische Version des Burgfriedens, und die ebenfalls wie in Deutschland ab 1917 betriebene Abschaffung des Parlamentarismus zugunsten einer autoritären Regierung, um den Krieg zu Ende zu bringen. Dies war nach der „Hölle von Verdun“ nötig geworden, da die Meutereien von 1917 einen Bruch in der „Union Sacrée“ und sich ausbreitenden Defätismus belegten, dem Clemenceau durch eine Radikalisierung der Kriegsführung entgegenwirkte.
Der folgende Versailler Vertrag wird in Kapitel 6, „Der prekäre Frieden„, näher beleuchtet. Der Ausgang des Krieges war für das Land, trotz des Sieges, katastrophal. Gewaltige Verluste und Zerstörungen bedeuteten die Notwendigkeit gewaltiger Ausgaben für den Wiederaufbau, die das Land aus Reparationen zu stemmen hoffte. Genau dies erwies sich als unmöglich, auch nach der Besetzung des Ruhrgebiets, die es im Endeffekt zwang, seine Finanzpolitik unabhängig von den Reparationszahlungen zu gestalten und Steuererhöhungen durchzusetzen, um die Kriegskosten zu decken (die es anders als Deutschland nicht weginflationieren hatte können). Die französischen Sicherheitsinteressen konnten durch die „Enttäuschung von Versailles“ auch nicht gedeckt werden; die folgenden Bündnisse mit den neuen osteuropäischen Staaten waren ein unvollständiger Ersatz. Letztlich basierte Frankreichs Sicherheit darauf, dass der Völkerbund wie versprochen funktionierte, was aber wegen des amerikanischen Rückzugs in den Isolationismus, dem bald der britische folgte, praktisch unmöglich war. Die Sicherheitsgarantien von Versailles waren damit bereits 1920 hinfällig, der Versuch, Deutschland alleine niederzuhalten, scheiterte letztlich 1923. Der Verzicht darauf, im Friedensvertrag wesentlich aggressivere Ziele durchzusetzen, schuf daher neue Probleme.
Zudem gab es starke innenpolitische Spannungen. Die französische Rechte instrumentalisierte die „Union Sacrée“ in eine neue, aggressiv-abgrenzende Bedeutung, nach der diese für die politische Rechte galt, die „wahre Franzosen“ gegen die Republikaner und Sozialisten stellte. Letztere waren durch die Geschehnisse in Russland exponiert, die einerseits (ebenfalls wie in Deutschland) die Spaltung der Linken in Kommunisten und Sozialisten bedeutete, andererseits aber die Linke als totalitäres Schreckensbild inszenierfähig machte. Auch außenpolitisch war dies wegen des Verhältnisses zur Sowjetunion bedeutsam, die man natürlich gerne in die Sicherheitsarchitektur gegen Deutschland integriert hätte. Zudem forderten die Arbeiter endlich die gesellschaftliche Gleichberechtigung ein, die ihnen in der Republik bisher verwehrt gewesen war. In einer Serie aggressiver Streiks legten sie das Land lahm, um grundsätzliche Zugeständnisse der Arbeitgeber und der staatlichen Sozialgesetzgebung zu erzwingen. Wie in Deutschland auch waren ihre Gewinne dabei stets prekär und schufen eine aggressive Abwehrreaktion der radikalen Rechten, die im sich entwickelnden rechtsextremistischen Milieus und seinem Versprechen auf „Einheit“ anschlussfähig war.
Zuletzt erlebte das Land einen „Höhepunkt des Imperialismus“, da es seine Kolonien um die Mandatsgebiete der Versailler Friedensordnung erweitern konnte und nun mehr Kolonialgebiete als je zuvor beherrschte. Gleichzeitig war der Anspruch, diese Gebiete zu entwickeln, nun auch durch die völkerbundliche Mandatierung vorgegeben. Die zunehmende Kluft zwischen diesem Anspruch und der kolonialen Praxis würde sich noch schwerwiegend auswirken.
Der zweite Querschnitt in Kapitel 7, „Frankreich um 1926„, wirft auf einen Blick auf die „verrückten Jahre“, die „années folles„, wie man die „Goldenen Zwanziger“ in Frankreich nennt. Waechter betrachtet zuerst die Erinnerung an den Großen Krieg, der durch die Veteranenverbände, denen teilweise bis zu 80% aller Veteranen angehörten, geprägt war und einen komplett anderen Verlauf nahm als in Deutschland, wo die Verbände wie der „Stahlhelm“ zu Vorfeldorganisationen des Faschismus und Nationalsozialismus wurden. In Frankreich war die Grundstimmung pazifistisch; der Krieg wurde als furchtbare Verschwendung gesehen, deren Wiederholung es unbedingt zu verhindern galt. Das zeigte sich auch an den Kriegsdenkmälern, die pointiert nicht den Sieg feierten, sondern der Toten als Opfer einer Katastrophe gedachten.
Weiter geht es in Teil 2.

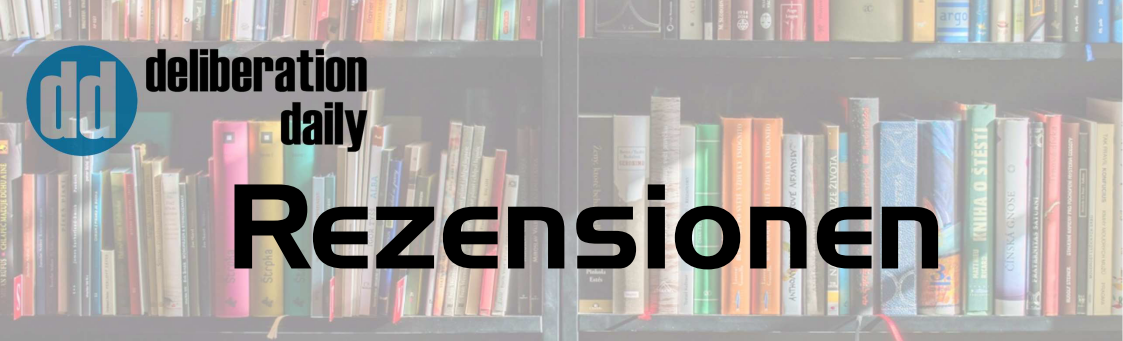


Hoert sich insgesamt wie eine vernuenftige Uebersicht an.
Vor der Standardisierung der Sprache durch das Schulsystem gab es eine viel groessere Variabilitaet. Mit bretonisch gab es ja sogar eine keltische Sprache. Heute wird versucht, die Regionalsprachen in der Schule und sonstige Bildungsangebote wiederzubeleben. Diese Sprachen bilden schon eine Art Kontinuum, d.h. ich kann einiges in Okzitanisch von Franzoesisch und anderes von Spanisch her lesen. In Spanischen und Italien haben sich in einigen Regionen (sueditalienische Dialekte, Galizien und v.a. Katalonien) die Regionalsprachen besser gehalten.
Die Kolonialisierung in Afrika begann bereits 1830 mit der Eroberung Algiers. Mit erstaunlich kleinen Truppen konnte die Herrschaft ueber ein riesiges Territorium und viele Menschen durchgesetzt werden. Frankreich stolperte da auch ein bisschen rein. Algerien war zunaechst eine Siedlungskolonie. Es wurde auch Land an Italiener und Spanier verteilt. Der Zugang der Araber und Berber zu medizinischer Versorgung und v.a. Schulbildung lief aeusserst schleppend an. Die europaeischen Neusiedler entwickelten schon sehr rassistische Mentalitaeten, aber so war halt die Zeit. Das Geschaeftsmodells Algiers bestand vorher jahrhundertelang in der Piraterie mit Loesegeldforderungen und Sklaverei sowie der Jagd nach Sklaven, v.a. auf den italienischen Inseln und der sueditalienischen Kueste.
Das dynamische Bevoelkerungszentrum ist eher Île-de-France, d.h. die gesamte Region um Paris einschliesslich des Kerns. Paris selber ist ja geographisch erstaunlich klein und von Hausmann von 1853 bis 1870 in vielen Teilen gentrifiziert worden. Die Massen an Arbeitsmigranten aus der franzoesischen Provinz, Italien und Polen siedelten sich in der Banlieu rund um Paris an. Die Gentrifizierung wurde durch eine extreme Mietpreisbremse 1910 bis in die 50er Jahre konterkariert, allerdings schwankte die Bevoelkerungsentwicklung in Paris selbst zwischen 2 und 3 Mio, in der Region Île-de-France heute 12,5 Mio.
In Frankreich blieb eigentlich bis heute die Landwirtschaft erstaunlich wichtig, jedoch entwickelte sich in einigen Regionen schon eine Schwerindustrie mit brutaler Ausbeutung der Arbeiter. Zolas Germinal ist wohl einer der besten Arbeiterromane. Die Handlung ist im nordfranzoesischen Kohlerevier statt.
Diese Wiederbelebung der Dialekte heute ist auch immer ein konservatives Projekt, das haben wir hier in Deutschland ja auch mit dieser regelmäßigen Sommerlochdebatte, ob man ein Schulfach Schwäbisch braucht…da kann man leicht ein identitätspolitisches Bekenntnis zur Region abgeben.
Katalanisch und Sizilianisch haben sich gehalten. Dafür gibt es auch Gründe. Lombardisch ist untergegangen, weil es viele Einwanderer gab.
Problem von so Regionalsprachen ist, dass sie selbst wieder in unterschiedliche Dialekte zerfallen.
Die französischsprachigen Schweizer sprechen Standard-Französisch. Die haben kein Äquivalent zum Schwyzer-Deutsch.
Das ist eher eine gemütlich-deutsche Perspektive. In anderen Ländern mit stärkerem Zentrum-Region Konflikt können Regionalidentitäten (und die dazugehörige Sprache) schnell in politische Radikalität umschlagen. Zum von Lemmy Caution erwähnten Bretonischen gehört auch die ARB. Und in Korsika ist nicht nur die ‚corsu‘ Sprache zu Hause sondern auch die FLNC. Beide Organisationen haben für ihre Regionalidentität dutzende Anschläge verübt – was ich mir bei „Bairisch als Schulfach“ Landtags-Hinterbänklern nicht so recht vorstellen kann.
So politisch ist das auch nicht unbedingt. Okzitanisch war ja bis ins 20. Jahrhundert eine wichtige Sprache. Das wird heute teilweise an manchen Schulen angeboten. Ich persönlich lerne eigentlich immer nur Sprachen von fetten Kolonialreichen, weil die einfach die meisten Sprecher und Medienerzeugnisse sprechen.
Der youtuber Metadron mag die sizilianische Regionalsprache, mit der er aufgewachsen ist: https://www.youtube.com/watch?v=07VumMvUAxQ
True. Ich mag das Gemütlich-Deutsche.
Das sind keine Dialekte sondern eigene Sprachen, z.B. Bretonische, Irish, Walisisch oder auch Samisch.
Ich bin auch gar nicht sicher, ob Erhalten oder Wiederbeleben immer konservativ ist. Ich dachte viele Bewegungen, die das auch als Teil ihrer Identität haben (z.B. Unabhängigkeitsbewegungen) seien eher links, revolutionär unterwegs.
Separatisten sind immer ein wenig revolutionär, aber sie sind gleichzeitig auch Nationalisten, das macht das „links“-Label etwas schwer. Aber du hast natürlich Recht, Sprachen=/Dialekte, da gelten unterschiedliche Bedingungen. Ich nehme meine Aussage nur auf Deutschland zurück.
Guter Punkt.
Ich habe die Sprachbewahrung in diesen Fällen immer v.a. als Minderheitenschutz = Links wahrgenommen, aber das wir der Vielfältigkeit auch nicht gerecht.
Man muss das wahrscheinlich im Einzefall betrachten.
Ich glaube, das entzieht sich dieser dichothomie einfach…
Ob National-/Autonomiebewegungen „links“ oder „rechts“ stehen, ist natürlich von der Definition dieser sehr schwammigen Begriffe und dann von der jeweiligen Konfliktkonstellation, also auch vom Charakter des Gegners, abhängig. Hobsbawm z.B. hatte argumentiert, dass Nationalismus in verschiedenen historischen Phasen zwischen links und rechts hin- und herwechselte. Ein Beispiel für linken Nationalismus sind bei ihm u.a. nationale Widerstandsbewegungen gegen den NS-Imperialismus – sicher ein Extrembeispiel, das das Argument aber gut veranschaulicht.
Von unserem direkten Nachbarn und wichtigstem EU-Partner wissen und erfahren wir in den Medien weniger als von den USA. Liegt es an der Sprache?
Danke für die Rezension. Ich hoffe, im 2. Teil kommt Gesellschaftsgeschichte stärker vor. Entwicklung von Bildungssystem, Gesundheitssystem, Stellung des Militärs usw. – von allem weiß man (ich zumindest) zu wenig.
Und kulturelle Affinität.
Bisher nicht, ich bin jetzt am Ende des Zweiten Weltkriegs.
Das mit dem „weniger wissen“ gilt auch für die Niederlande, Belgien, Polen, Tschechien etc. IMHO weniger Sprache als „Bedeutung für uns“ – und da waren bisher in der politischen Wahrnehmung Deutschlands alle genannten Länder wie Frankreich weniger bedeutend für unser Schicksal. Das kann sich jetzt ändern (worauf ich nicht wetten würde).
Gruss,
Thorsten Haupts
Aber Frankreich ist doch noch mal ne andere Nummer mit der Geschichte (Erbfeindschaft, drei Kriege), und dann die „Achse“/der „Motor“ als Basis der EU. Und aktuell im Umgang mit Russland und Nahost.
Sprache, ja: Auf beiden Seiten der Grenze nimmt das Interesse von Schüler*innen und Student*innen an der Sprache des anderen Landes ab, wenn ich richtig informiert bin. Alle Welt spricht Englisch und sowohl Französisch als auch Deutsch werden wechselseitig als schwierig und nicht besonders sexy wahrgenommen.
Es gibt auch intellektuelle Moden: Frankreich ist heute nicht mehr so cool wie vor 50 Jahren. Die Leute, die „irgendwas mit Medien“ machen und unsere kollektive Aufmerksamkeit lenken, konsumieren vermutlich anteilig heute mehr US-Kultur, waren zum Austauschsemester eher dort. Das merkt man ja schon an der Ausrucksweise von Journalist*innen.
Ich wohne nah an der Grenze zum Elsass und finde es bedrückend, wie hart die Grenze in kultureller Hinsicht geworden sein muss. Trotz allem Europakult auf der Gedenk- und Politikebene – der natürlich eine große Errungenschaft ist – war das vermutlich noch nie so extrem wie heute. Noch während des Ersten Weltkrieges waren die kulturellen und sprachlichen Übergänge in der Rheinebene sehr fließend, auch einfache Leute hatten familiäre Verbindungen auf die andere Seite usw. Heute lebt man in nationalen Parallelwelten. Ich frage mich, was das langfristig politisch bedeutet.
Leider wahr. Auch der Versuch, entlang der Rheinschiene Französisch als 1. Fremdsprache zu etablieren, ist am Widerstand der Eltern gescheitert.
Soviel ich weiß, hat auch das Interesse am Schüleraustausch nachgelassen und die Frankophilie des Bildungsbürgertums. Städtepartnerschaften werden – noch – von den Älteren getragen.
Im Saarland scheint es noch anders zu sein.
Französisch ist einfach eine blöde Sprache zum Lernen und hat keinen praktischen Nutzen. Nett, wenn man da Bock drauf hat, aber sonst…?
The Benefits of Failing at French 😉
https://www.nytimes.com/2014/07/16/opinion/16alexander.html
In den Bereichen, von denen ich etwas mitkriege (Hochschulen, Archivdienst, Informations-/Bib-Wesen, Geschichtsberufe), erhöhen Französischkenntnisse schon die employability, zumindest in einigen Regionen, das ist wohl hoffentlich ein „praktischer Nutzen“.
Aber mir ist hier natürlich die Frage der politischen Bildung wichtiger. Dieses wichtige Nachbarland besser verstehen, das geht wohl nicht ganz ohne die Sprache. Gerade weil Medien und die zuständigen Wissenschaften ihre Vermittlerposition vernachlässigen.
Ja. Aber es gibt einen Unterschied zwischen „hat Französisch in der Schule gehabt“ und „kann Französisch“.
Sehr schwierig. In einer stetig kleiner werdenden Welt (durch grössere Mobilität) nimmt die wahrgenommene wie tatsächliche Bedeutung von freundlichen bis neutralen Nachbarstaaten zwangsläufig ab. Ich weiss gar nicht, wie man diesen Trend umkehren kann, ausser durch die drastische Begrenzung von Mobilität.
Ich realisierte bei Deiner Besprechung des offenbar kundig und ansprechend geschriebenen Werkes: Das meiste davon wusste ich schon, durch Barabara Tuchmans grossartiges Werk über Frankreich vor dem ersten Weltkrieg (zentriert auf die Dreyfuss-Affäre), in Deutschland im Sammelband „Der stolze Turm“.
Wo ich energisch widersprechen würde: Frankreich als Nation musste nicht mehr „geschaffen“ werden. Das hatte der hundertjährige Krieg erledigt, an dessen Ende mit England und Frankreich die ersten Nationalstaaten Europas standen. Verfeinert und geschliffen vielleicht, geschaffen nein.
Gruss,
Thorsten Haupts
Es gab ein Bewusstsein von Frankreich als Nation und spaeter Republik. Ausserdem natuerlich einen zentralistischen Aufbau staatlicher Institutionen. Trotzdem wurde Standard-Franzoesisch erst im spaeten 19. Jahrhundert zur gemeinsamen Sprache.
Alle in Frankreich gesprochenen Sprachen ausser Elsaessisch und Bretonisch sind dem Franzoesischen aehnlich, aber z.B. ist Okzitanisch naeher beim Katalanischen als beim Franzoesischen. Katalanisch und Franzoesisch sind halt auch recht nah verwandt.
Hier Uebersichtskarte: https://de.wikipedia.org/wiki/Sprachen_in_Frankreich#/media/Datei:Langues_de_la_France.svg
„Nation“ im Ancien Régime wurde als vereinheitlichende Leitung der Staatsgeschäfte durch einen König verstanden, dem es gelingt, den Einfluß der unteren Ebenen des Landadels zuzüglich des klerikalen Quasi-Adels stetig zu verkleinern. Die – mit Unterbrechungen – ca. hundertjährigen Kriege (aus „der“ hundertjährige Krieg genannt) haben diesen Prozess tatsächlich wesentlich in Gang gesetzt, der spätere Protestantismus wurde (selbstverständlich auch durch Krieg) abgewürgt und weitgehend niedergeschlagen, auch das war hier wesentlich für die Nation im alten Sinn. Im mitteleuropäischen Reich gingen die Dinge bekanntlich in umgekehrter Richtung.
Die „neue Nation“ (sozusagen die 1789 ff-Nation) ist etwas durchaus anderes, nämlich das mehr oder weniger gelungene (meist nur prekär gelungene) säkulare Zusammengehörigkeitsgefühl breiter Schichten, insbesondere nicht-adeliger Schichten. Hier wird die Nation zu einem neuen Gott, der alte geht zunächst in den Vorruhestand, später ganz in Pension.
Der linguistische Ansatz ist natürlich auch interessant. Es gab ab der III. Republik und übrigens auch noch in der IV. eine robuste (schmeichelhaft ausgedrückt) Sprachpolitik. War das von großem Nutzen? Ist nicht ganz klar IMHO, denn heutzutage ist Regionalismus (einschl. linguistischer) ja eh wieder schwer angesagt^.
Das Ancien Régime war sprachpolitisch im Grunde „liberal“. Gegen das Alemannische im Elsass wurde nach den „Réunions“ nichts unternommen. Das Elsass blieb – insoweit – „deutsch“. Zeigt auch, dass es darauf bei der „alten“ Nation gar nicht ankam, anders als bei der „neuen“.
Waren nicht alle diese Fürstentümer sprachpolitisch „liberal“, weil es ihnen egal war? Die Oberschicht sprach Französisch, und die Unterschicht wurde ja gar nicht als Menschen wahrgenommen. Was die sprachen, war den Fürsten halt total egal, weil sie null Kontakt mit denen hatten.
Ja klar, sehe ich auch so. Das war bei nicht-republikanischen, sozusagen alten „Nationen“, wo der Begriff eh nur mäßig sinnvoll ist, uninteressant. Es musste erst die Idee der „freiwilligen“ Loyalität sub-adeliger Schichten zu einer angeblich gemeinsamen Sache her, damit eine gemeinsame Sprache ein Thema wurde.
Das ist sicher eine Zuspitzung, aber ich fand sie angesichts der von ihm beschriebenen Brüche und der Versuche der III. Republik, diese zu überwinden, für gerechtfertigt. Wir reden ja von 1865 in den USA auch vom „second founding“. Ich würde das in dem Kontext sehen.
hundertjähriger Krieg / Nationalstaatswerdung England und Frankreich:
Wenn sie das als entscheidenden Schritt ansehen, müssen Sie noch die inneren „Aufräumkonflikte“, die an den hundertjährigen Krieg anschlossen, dazurechnen. In Frankreich war das der Versuch Karls des Kühnen, ein Königreich Burgund zu etablieren und in England 30 Jahre Rosenkriege.
Hmmm. Ich nehme diese Auseinandersetzungen – die nicht mein Interessengebiet waren und sind – anders als Sie. Das Beispiel Burgund z.B. führt völlig in die irre – das damalige Burgund war nicht Teil Frankreichs. Und ob die Rosenkriege irgendeinen Beitrag zu dem Selbstverständnis Englands als Nation lieferten, halte ich für zweifelhaft – das war ein Elitenstreit darüber, wer diese Nation regieren sollte und durfte. Die Nation war der gegebene Fakt.
Man muss äußere und innere Nationalstaatsbildung unterscheiden (hilfreich dazu das Nationalismus-Kapitel in Osterhammels „Verwandlung der Welt“). Letztere war – wie auch in anderen Nationalstaaten – ein sehr langfristiger, gradueller Prozess der infrastrukturellen Durchdringung des Landes durch den Staat, der vor dem 19. Jh. sicher nicht abgeschlossen war.