Matthias Waechter – Geschichte Frankreichs im 20. Jahrhundert
 Das Land verschleppte zudem weiterhin den wirtschaftlichen Strukturwechsel. Die großen Konzerne bildeten Kartelle, um Konkurrenz auszuschließen und so international konkurrenzfähig zu bleiben, während die kleingewerbliche und agrarische Struktur der Wirtschaft sich zäh hielt. Der Wertverlust des Franc gegenüber Dollar und Pfund konnte nur durch einen Währungsschnitt erreicht werden, der unter der Schirmherrschaft des Kriegshelden Poincaré von der Bevölkerung trotz der riesigen Verluste auch akzeptiert wurde (man stelle sich vor, die deutsche Rechte hätte sich so hinter die unpopulären wirtschaftlichen Maßnahmen gestellt).
Das Land verschleppte zudem weiterhin den wirtschaftlichen Strukturwechsel. Die großen Konzerne bildeten Kartelle, um Konkurrenz auszuschließen und so international konkurrenzfähig zu bleiben, während die kleingewerbliche und agrarische Struktur der Wirtschaft sich zäh hielt. Der Wertverlust des Franc gegenüber Dollar und Pfund konnte nur durch einen Währungsschnitt erreicht werden, der unter der Schirmherrschaft des Kriegshelden Poincaré von der Bevölkerung trotz der riesigen Verluste auch akzeptiert wurde (man stelle sich vor, die deutsche Rechte hätte sich so hinter die unpopulären wirtschaftlichen Maßnahmen gestellt).
Paris indessen blieb das kulturelle Zentrum des Landes, auch mit der neu entstehenden Filmindustrie. Hier entstand auch ein fruchtbarer Dialog mit der angloamerikanischen Kunst, der eine beeindruckende kosmopolitische Offenheit der französischen Szene belegte, die dazu führte, dass mehrere schwarze Künstler*innen, alle voran Josephine Baker, in Frankreich ihre Wahlheimat suchten.
Kapitel 8, „Die Krise der 1930er Jahre„, befasst sich mit jener merkwürdigen Krisenzeit in den 1930er Jahren, als das Land zwar anders als die meisten anderen Länder des Westens nicht von einer kompletten Rezession betroffen war, aber in einer langen Stagnation steckte, aus der es kein Entkommen zu geben schien. Die in der zweiten Hälfte der 1920er Jahre stark gestiegenen Exporte brachen fast vollständig ein und konnten durch die schwache Binnennachfrage nicht kompensiert werden. Die Arbeitslosigkeit wurde auch niedrig gehalten, indem man ausländische Arbeiter*innen rücksichtslos auswies.
Weiterhin jedoch konnte, trotz des Erstarkens rechtsradikaler außerparlamentarischer Verbände wie der Feuerkreuzler, keine faschistische Bewegung in Frankreich Fuß fassen. Waechter begründet das vor allem mit dem tief verankerten Pazifismus der Franzosen, der die kriegsbejahenden Elemente des Faschismus für das Land unattraktiv machte. Innenpolitisch gab es einen Wandel von den Rechtsregierungen zwischen Konservativen und „Radikalen“ hin zu einer Linksregierung, bei der die „Radikalen“ mit den Sozialisten und Kommunisten, die anders als in Deutschland sich der Zusammenarbeit nicht verweigerten, zusammenschlossen. Diese „Volksfront“ kam 1936 an die Macht und führte ein beispiellos gewaltiges innenpolitisches Reformprogramm durch, das dennoch hinter den Erwartungen zurückblieb. Als Léon Blums Regierung gegen Streikende vorgehen musste, brach auch die Einheit der Linken wieder. Gleichzeitig wuchs die französische extreme Rechte immer mehr. Gewalt auf den Straßen zwischen Kommunisten und Faschisten nahm zu, und die Aufrechterhaltung der Ordnung durch die Volksfrontregierung, die auch Opfer auf der politischen Linken forderte, führte zum Bruch des ersten linken Kabinetts der französischen Geschichte.
Außenpolitisch war die Zeit vom Versuch der Integration Deutschlands in die Friedensordnung und einem gemeinsamen Auskommen geprägt. Doch als das Land unter Hitlers Führung den Versailler Vertrag zu revidieren suchte, blieb eine eindeutige Antwort Frankreichs aus. Zu kriegsmüde war die Bevölkerung, zu pazifistisch eingestellt: eine Intervention stand politisch außer Frage. Die Appeasement-Politik fand breite Unterstützung nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Frankreich, und so war das Land auf den Krieg mit Deutschland beklagenswert schlecht vorbereitet, auch wenn ab dem Frühjahr 1939 eine Entschlossenheit zur Verteidigung entstand, die Hitler im Sommer 1939 überraschen sollte (und bald wieder erodieren).
Der dritte Teil, „Vom Zusammenbruch zur Dekolonisierung„, behandelt die Jahre 1940 bis 1962. Dass 1940 einen schwerwiegenden Einschnitt in die französische Geschichte bedeutete, dürfte klar sein. Der „Waffenstillstand“ – eigentlich eine Kapitulation – läutete das Ende der Republik ein.
In Kapitel 9, „Die zerstörte Einheit„, zeigt Waechter auf, wie der Zusammenbruch durch die Krise der 1930er Jahre einerseits, aber auch durch die zermürbende und die Moral völlig erodierende Untätigkeit des „Droles de Guerre“ (Sitzkrieg) entstand und die Einheit des Landes sowohl territorial als auch gesellschaftlich und politisch bedeutete. Die Aufteilung in Besatzungszonen zerstörte die territoriale Einheit, aber die Einsetzung Pétains als „Held von Verdun“ als Diktator auf Zeit erwies sich als, wenngleich weithin gefeierter, Fehlgriff. Die Abschaffung der Republik war damals selbst unter „Radikalen“ mehrheitsfähig, doch Pétain erwies sich als in seiner Kollaboration viel zu weitgehend und bezüglich Deutschlands Chancen zu defätistisch. Die Rechten errichteten den antirepublikanischen, xenophoben und antisemitischen Staat, den sie sich schon lange gewünscht hatten, doch entstand unter de Gaulle in London ein Gegenzentrum, das Waechter von drei Hauptstädten reden lässt: das kollaborierende Vichy, das widerständige London und das besetzte Paris dazwischen, das auch die Trennlinien in der Bevölkerung verkörpert, die in den folgenden Jahren deutlich werden würden.
Vichy war eine merkwürdige Konstruktion. Nicht vollständig faschistische Diktatur, mit einem beinahe entpolitisierten Pétain darüber schwebend, vollständig bereit zur Kollaboration und rettungslos in die NS-Verbrechen verstrickt, von der Bevölkerung aber getragen. Die Politiken Vichys selbst waren widersprüchlich und teils anachronistisch, gerade auf wirtschaftlichem Gebiet. In London indessen versuchte de Gaulle, sein „freies Frankreich“ als legitime Regierung zu installieren, vor allem mit der Zielsetzung, zum Anführer aller Widerstandsgruppen in Frankreich zu werden. Und in Paris zeigte sich das Besatzungsregime mit einer merkwürdigen Mischung aus Zurückhaltung der Deutschen, die mit extrem dünner Personaldecke operierten, und bereitwilliger Kooperation der französischen Verwaltung, ohne die die Besatzung gar nicht möglich gewesen wäre.
Kapitel 10, „Frankreich um 1942„, baut diese Aspekte im nächsten Querschnitt weiter aus. In diesem Jahr intensivierte sich der Widerstand (auch durch den durch den deutschen Überfall auf die Sowjetunion induzierten Strategiewechsel der Kommunisten, die auf Weisung Moskaus ihre Kollaboration einstellten und in den offenen Widerstand wechselten, der soweit ging, dass „Widerstand“ und „Kommunisten“ praktisch synonym wurde), während das Vichy-Regime in eine Legitimationskrise geriet, aus der es sich nicht erholen würde. Die intensivierende Judenverfolgung einerseits (die ohne die Kollaboration nicht möglich gewesen wäre) und die militärischen Niederlagen in Afrika andererseits bildeten den Hintergrund der Besetzung ganz Frankreichs im November des Jahres.
De Gaulle selbst wurde durch militärische Fehlschläge vor allem in Nordafrika seinerseits isoliert und konnte nur durch die zähe Einigung der disparaten französischen Widerstandsgruppen unter seiner Schirmherrschaft – stark unterstützt durch die zunehmend repressive deutsche Politik – seine Exilregierung wieder als Player etablieren. Vichy-Überlaufer wie Darlan und Giraud verkomplizierten das Bild das Bild noch zusätzlich. Auch die Kooperation Frankreichs bei der Verfolgung der Juden findet ihre Würdigung und stellt sicher kein Ruhmesblatt für das Land dar. Waechter schließt das Kapitel mit einigen biografischen Skizzen von Widerständlern wie Stéphane Hessel oder Kollaborateurinnen wie Coco Chanel, die die Bandbreite französischen Verhaltens jener Zeit offenlegen und den späteren Résistance-Mythos Lügen strafen.
Kapitel 11, „Der schwierige Aufbau einer neuen Ordnung„, setzt mit der Befreiung Frankreichs 1944 ein. Waechter stellt fest, dass die Franzosen im Großen und Ganzen politisch indifferent waren und weder der einen noch der anderen Seite sonderlich zugeneigt waren, was er auch mit den Härten des Besatzungsalltags erklärt. Innerhalb Frankreichs spricht er allerdings durch die Gründung der faschistischen „Milice„, die mit brutaler Gewalt gegen die Widerstandsgruppen vorging, von einem Bürgerkrieg. De Gaulle und seinen Verbündeten gelang es in jenen Tagen, den Mythos der „Selbstbefreiung“ Frankreichs zu etablieren, der für die Legitimität der neuen Ordnung so grundlegend sein sollte. Gleichzeitig sabotierte de Gaulle aber das Entstehen einer „Résistance“-Partei, da er die vielen Kollaborateure einbinden wollte. Stattdessen konzentrierte er seine Energie auf die Schaffung einer neuen, exekutivlastigen Verfassung mit ihm an der Spitze. Dies scheiterte; die Vierte Republik war erneut mit einer starken Legislative ausgestattet.
Indessen änderte sich die wirtschaftliche Verfassung deutlich. Gewerkschafts- und Streikrecht wurden massiv ausgebaut und auch angesichts der schlechten Wirtschaftslage direkt genutzt. Der französische Staat mischte sich wesentlich stärker ins Wirtschaftsleben ein als in den anderen westlichen Ländern, wenngleich das französische Planen wenig mit dem realsozialistischen gemein hatte. Eine treibende wirtschaftspolitische Kraft war Jean Monet, der nicht nur diese Planung aufbaute, sondern auch gleichzeitig eine strategische Modernisierungsvision verfolgte, die in einer engen wirtschaftspolitischen Anbindung Frankreichs an die USA bestand, was gleichzeitig die Marktwirtschaft stärkte und eine fruchtbare Synthese ergab.
Das Herzstück von Monets Wirken aber war die EGKS, die gleichzeitig französische Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen befriedigen sollte und der unrealistischen Vision der Gaullisten von Frankreich als einer unabhängigen „dritten Kraft“ im Weltsystem diametral gegenüberstand. Der Wahlsieg der Gaullisten 1951, die sich in Fundamentalopposition mit den Kommunisten verbanden, schon allein, weil sie eine Auflösung des französischen Empires befürchteten, verhinderte den Integrationsschritt der EVG; die Gründung der EWG und Euratoms konnte er gleichwohl nicht verhindern, womit der europäische Einigungsprozess zwar gebremst und verrechtlicht, aber nicht aufgehalten worden war. Ohnehin war das drängendste Problem der Krieg in Algerien und Indochina, wo das Kolonialreich – von der französischen Öffentlichkeit weitgehend desinteressiert ignoriert – zu zerbröseln begann.
Kapitel 12, „Die Auflösung des französischen Empires„, befasst sich nach einer schnellen Abhandlung des sowohl politisch als auch, entscheidender, militärisch verlorenen Indochinakriegs vor allem mit dem französischen Afrika, und hier vor allem Algerien. Während Frankreich in zahlreichen Ländern blutig die Nationalbewegungen unterdrückte und so oft frankreichfreundliche Diktatoren in Stellung bringen konnte, misslang das neben Indochina auch in Algerien. Die Kolonie hatte wegen der französischen Siedler*innen eine Sonderstellung im Kolonialreich inne. Während die FLN mit terroristischen Methoden gegen die Kolonialmacht vorging und dabei auch einen inneralgerischen Bürgerkrieg auslöste, der zahllose Opfer forderte, radikalisierte sich die französische Armee immer mehr in zahlreichen Gewaltorgien gegen die algerische Bevölkerung, die das Land neben der völlig fehlgeschlagenen Suez-Besetzung internationale Unterstützung kosteten und den Krieg zunehmend unhaltbar machten.
In der französischen Bevölkerung polarisierte er ähnlich wie die Dreyfus-Affäre; auf der einen Seite die Konservativen, das Militär und die Justiz, die offen die Folter und Bluttaten unterstützten, auf der anderen Seite die Linke, die die französische Kriegsführung verurteilte und für die Unabhängigkeit eintrat (und oft genug den Terror der FNL ignorierte oder relativierte). Zwischen den Stühlen saßen Menschen wie Albert Camus, die weder der einen noch der anderen Seite zuneigten. 1968 würde die antikolonial geschulte Linke ihren großen Moment haben.
Der Algerienkonflikt indessen führte zum Ende der Vierten Republik. Der versuchte Putsch vierer Generäle, an dessen Spitze sich de Gaulle setzte, um die fünfte Republik ins Leben zu rufen, führte einerseits zu einer Intensivierung des Krieges und andererseits zu seiner langsamen Abwicklung. De Gaulle wandte sich nach seiner Machtübernahme gegen die Militärs und Siedelnden und suchte eine Verhandlungslösung mit dem FNL, für den das Land vorher befriedet werden sollte. Beim Militär entstand so die Dolchstoßlegende vom militärischen Sieg, der politisch verschenkt worden war, und führte zur Gründung der Terrororganisation OAS, die sowohl in Algerien als auch Frankreich Bluttaten verübte. Die Siedelnden wurden nach Frankreich evakuiert, das gleichzeitig aus rassistischen Motiven den algerischen Hilfstruppen die Evakuierung verwehrte – und zehntausende dem folgenden Rachemassaker der FNL überließ.
Weiter geht es in Teil 3.

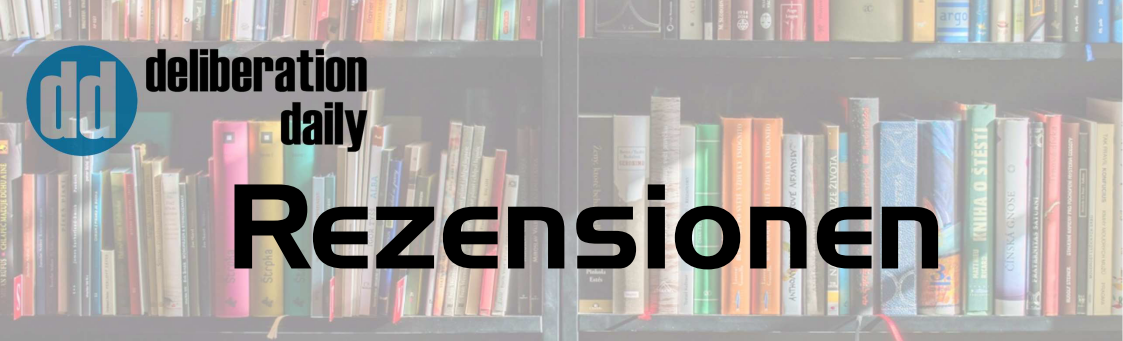


In Frankreich wird das Thema der Kollaboration mit den faschistischen Besatzern seit spaetestens den 80ern intensiv diskutiert. Andererseits erscheint der Algerienkrieg immer noch als eine Art offene Wunde. Kuerzlich gabs im besten mir bekannten yt-Kanal ueber Geschichte eine 3-teilige Serie ueber die Kolonialisierung und die Befreiung des algerischen Volkes.
https://www.youtube.com/@notabenemovies/featured
In seiner beruehmten Rede vom 6. Juni 1940, schloss De Gaule das Kolonialreich als unbesetzten Kern, von dem aus der Widerstand starten wird, explizit mit ein.
Es gibt bis heute Afrikaner, die sich zu Frankreich und einem afrikanischen Land bekennen. Das ist alles sehr vielschichtig.
In Algerien liess Frankreich im 19. Jahrhundert neben Franzosen auch viele Italiener und Spanier ansiedeln. In Abgrenzung zu Tunesien und dem Protektorat Marokko nahm Algerien eine Sonderstellung ein. Die Araber und Berber wurden aber so stark diskriminiert, dass sich ein franzoesisches Algerien nicht halten konnte. Die Beziehung zwischen Algerien und Frankreich ist bis heute viel konfliktiver als die zwischen Marokko und Frankreich.
Die Franzoesische Sprache haelt sich recht gut in Afrika, v.a. auch als lingua franca innerhalb der Nationen. Die sprechen oft mehrere bis viele unterschiedliche eigene Sprachen, aehnlich wie das Englische in Nigeria oder Indien.
Ja, diese Vielschichtigkeit kommt im Buch auch zu ihrem Recht, ich dampfe das für die Rezension ja schon sehr ein 😀
Mein Beitrag war ja keine Kritik.
Oki danke 🙂
Danke für die Rezension, sehr lesenswert. Vielleicht kauf ich mir das Buch mal. Wenn ich über deinen Blog klicke, kriegst du ja eine Riesenprovision und wirst richtig reich.
Trotz intensiven Suchens nach möglichen Beanstandungen^^ hab ich eigentlich nichts zu meckern, aber eins scheint mir dann doch nicht so ganz korrekt, eigentlich sogar etwas irreführend:
Zitat Stefan Sasse:
„Der versuchte Putsch vierer Generäle, an dessen Spitze sich de Gaulle setzte, um die fünfte Republik ins Leben zu rufen“
Nee, IMHO hat er das jedenfalls so nicht gemacht. Es gab zwar eifrige „gaullistische“, sozusagen Verbindungsleute in Algier, er hielt sich aber betont neutral und bedeckt, im Hexagon in Ruhe abwartend im Wissen, dass die Dinge quasi automatisch auf ihn zulaufen. Der De Gaulle hatte noch nicht einmal eine Wohnung in Paris, sondern pflegte von Zeit zu Zeit (sein Dorf in Lothringen verlassend) in einem bescheidenen Mittelklassehotel abzusteigen, das es heute noch gibt…..
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6e/Hôtel_La_Pérouse%2C_rue_La_Pérouse%2C_rue_Jean-Giraudoux%2C_Paris_16e_1.jpg/1439px-Hôtel_La_Pérouse%2C_rue_La_Pérouse%2C_rue_Jean-Giraudoux%2C_Paris_16e_1.jpg
(Das Graffito stammt vermutlich nicht von der Hotelleitung^. Das „Refugees Welcome“ hat einen gewissen entfernten, wohl nicht bedachten Bezug zum seinerzeitigen Hotelgast und der mit selbigem eng verbundenen Algeriensache. Der Willkommensempfehlung sind die Franzosen aber schon damals eher nicht gefolgt^ )
……und wo er sich von Gewährsleuten – man kann fast sagen: geheimdienstlich – über die laufenden Ereignisse unterrichten ließ. Niemand sollte auf die Idee kommen, das er irgendwelche „Pläne“ habe. Der Putsch vom Mai ’58 kam ihm gelegen, selbst involviert war er keineswegs und hat sich noch im selben Jahr von den Putschisten öffentlich distanziert und einen Waffenstillstand in Algerien vorgeschlagen (von der FLN abgelehnt). Der Vorschlag („paix des braves“) hat zunächst keineswegs einen Waffenstillstand bewirkt, aber bei den Putschgenerälen vermutlich eher einen Herzstillstand, die ja zunächst den Eindruck hatten, der De Gaulle ist quasi „einer von uns“, ein Eindruck, dem der De Gaulle zunächst auch keineswegs entgegen getreten ist, später erwies sich der Eindruck aber als eher oberflächlich^.
Als die Granden der IV. Republik mit ihrem Latein am Ende waren haben sie sich in De Gaulles Absteige begeben…
https://images-cdn.bridgemanimages.com/api/1.0/image/600wm.XXX.39406610.7055475/1657314.jpg
…und der ließ sich bitten. Sodann wurde er von der Nationalversammlung (im rechtlichen Rahmen der IV. Republik!) zum MP mit besonderen Vollmachten gewählt. Die Linke hat sich bei dieser Gelegenheit gespalten, wie immer^. Der „Retter“ also. Sehr typisch für Frankreich. Auf Legitimität (sagen wir mal: Eine gewisse Legitimität^) hat er immer schwer geachtet. Er war alles Mögliche, aber mitnichten ein Putschgeneral.
Der Oberputschist Massu hat später zur Abwechslung gegen De Gaulle geputscht (1961), wurde abgesetzt, aber noch später wieder rehabilitiert. Alles sehr komplex^.
Was waren De Gaulles genaue Pläne betreffend Algerien im Mai ’58 und im Laufe des Jahres? Die große Rätselfrage, die bis dato noch niemand überzeugend beantworten konnte. Viele Historiker behelfen sich häufig damit: Er wusste das selbst noch nicht genau. Das kann durchaus so sein, aber klar war: „L’Algérie de Papa est morte“. So O-Ton De Gaulle, 1959.
Und dann die Harkis:
Zitat Stefan Sasse:
„Die Siedelnden wurden nach Frankreich evakuiert, das gleichzeitig aus rassistischen Motiven den algerischen Hilfstruppen die Evakuierung verwehrte“
Ist IMHO maximal die halbe Wahrheit, eher weniger. Ungefähr 80.000 Harkis kamen nach Frankreich und galten als „repatriiert“, also französische Staatsbürger, wurden aber von der breiten Masse und allerlei lokalen Beamten und Politmenschen nicht unbedingt als „richtige“ Franzosen anerkannt. Dergleichen Ansichten kommen einem aus aktuellen Verhältnissen bekannt vor^. Daneben ungefähr eine Millionen Pieds noirs (die meisten der Letztren stammten ursprünglich aus Spanien und Italien und nicht aus Frankreich). Dass die Pieds noirs nett und freundich im Hexagon empfangen wurden, kann man auch nicht grad sagen, vor allem auch von De Gaulle nicht, der zu niemanden nett und freundlich war^.
Zitat Stefan Sasse:
„und zehntausende dem folgenden Rachemassaker der FNL überließ.“
„Rache“, also Ausschreitungen hat die algerische Seite im Vertrag von Evian ausdrücklich ausgeschlossen und zu verhindern versprochen. Waren die Rachemassaker dennoch zwingend, wie ein Erdbeben, und „eigentlich“ hat Frankreich sowieso die Schuld, klarer Fall? Diese vereinfachte Ansicht würde der in gewissen Kreisen beliebten Dritte-Welt-Romantik (die Guten) entsprechen, stimmt aber nicht so ganz, vorsichtig ausgedrückt.
Wie komplex das alles ist kann man auch hier nachlesen:
https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/view/792/1309/109921
Passt alles prima ins beliebte Links-rechts-Schema? Nee, ganz gewiß nicht.
Die Aufräumungsarbeit im Hinblick auf bequeme Algerien-Mythen in F kam später (sehr viel später) übrigens wesentlich von Chirac (rechts) und nicht etwa von Mitterrand (angeblich links; eifriger Anhänger von Algérie française, was später „vergessen“ wurde bzw. werden sollte). O-Ton Mitterrand als Minister in den 50ern: „La seule négociation, c’est la guerre“.
Zitat Stefan Sasse.
„1968 würde die antikolonial geschulte Linke ihren großen Moment haben.“
Mehr als ein Moment (ca. 14 Tage im Mai) war das tatsächlich nicht und der brach kläglich zusammen. Das zu diesem Zeitpunkt beliebte Vietnam-Thema konnten die „Antikolonialisten“ – anders als in Deutschland – nicht groß herausstellen, weil der De Gaulle in dieser Sache durchaus ähnlicher Ansicht war. Es ging im Kern um andere Themen als „Antikolonialismus“. De Gaulle erschien ganz allgemein habituell als ein Mann von gestern. Nicht falsch. Im Übrigen ein weites Feld.
Stimme dir bei allem zu; wie so oft gesagt, ich verkürze zwangsläufig hier. Nur beim Pusch: Waechter spricht von einem „kalten Putsch“, was ich durchaus für zutreffend halte. Wenn Generäle dich ausrufen und du nicht sagst „nein, sorry, ich mach bei Putschen nicht mit“, sondern einfach mal in deinem Hotel wartest was passiert, ist das auch Teilnahme.
De Gaule sah die institutionelle Ordnung der 4. Republik als dysfunktional fuer Frankreich. Da wechselten ja staendig die Regierungen. Die 5. Republik setzte dann eine Grundlage fuer stabile Regierungen. Natuerlich arbeitete de Gaules Verhalten in Richtung auf einen Bruch der Ordnung (Kalter Putsch), allerdings gab es dafuer wohl eine Mehrheit in der Bevoelkerung.
Die gab es, aber das ändert nichts dran, dass es ein kalter Putsch war.
Kann man so sehen, aber es war auch nicht sonderlich schwer, unter den gegebenen Umständen die alte Ordnung umzupusten. Die Nationalversammlung war wahrscheinlich überwiegend froh, dass sie nach Hause geschickt wurde. Und keiner von den Trägern der IV. Republik wurde ja ins Gefängnis geschmissen^, vielmehr gab es eine relativ breite Beteiligung der „alten Kräfte“, u.a. auch der Sozialistenführer Mollet, an der Interimsregierung De Gaulle, also quasi der Abwicklungsregierung der IV. Republik. Natürlich im weiteren Verlauf jede Menge Stress und Streit und Seitenwechsel, wie in Frankreich üblich; neue De Gaulle-Gegner, die zuvor Befürworter waren, und, und.
Behaupte ich ja auch nicht. Es geht nur um die Analyse. Und das war halt kein verfassungsmäßiger Übergang, egal wie unbeliebt die 4. Republik war.
Es gab im Herbst ’58 ein Referendum über die ausgearbeitete neue Verfassung. Zustimmungsquote: ca. 82 %.
Wenn Generäle dich ausrufen und du nicht sagst „nein, sorry, ich mach bei Putschen nicht mit“, sondern einfach mal in deinem Hotel wartest was passiert, ist das auch Teilnahme.
Moment, wenn mich morgen irgendwelche Militärs zum König von Deutschland ausrufen und ich nicht direkt widerspreche, nehme ich teil???? Du hast ja eine interessante Auffassung von persönlicher Verantwortung für Äusserungen anderer, die Du gar nicht beeinflussen kannst.
Gruss,
Thorsten Haupts
De Gaulle war die führende Repräsentationsfigur der Fundamentalopposition gegen die 4. Republik, das ist schon was anderes.